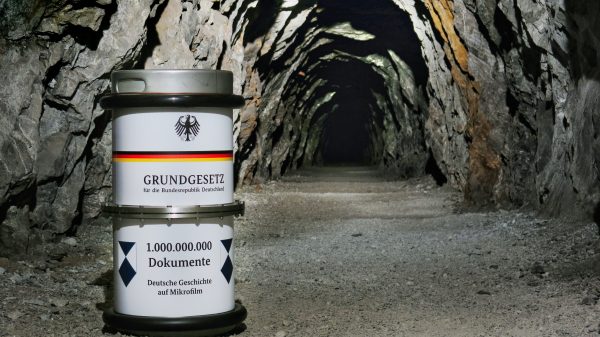Europa, aber vor allem auch Deutschland befindet sich in einem hybriden Konflikt mit autoritären Regimen, deren Ziel es ist die aktuelle Weltordnung zu verändern. Hierzu scheuen die Akteure nicht vor Desinformationskampagnen, Auftragsmorden, Sabotage, Drohungen, Cyberangriffen und Spionage zurück. Selbst bei Wahlen mischen diese Regime mit, so wie auch bei der aktuellen Bundestagswahl in Deutschland. Und auch der Ukraine-Krieg verdeutlicht noch einmal sehr genau, wie wichtig es ist, als Staat oder Staatenbündnis (NATO, EU) resilient und kriegsbereit (verteidigungsfähig) zu sein. Europa und Deutschland befanden sich in den letzten 30 Jahren – was Sicherheitspolitik betrifft – in einem Dornröschenschlaf, aus dem sie jetzt mit einem Schrecken wieder aufgewacht sind. Die konzeptionelle Antwort Deutschlands auf die neue Bedrohungslage, von Kanzler Scholz vor einigen Jahren als „Zeitenwende“ bezeichnet, ist der OPLAN Deutschland. Der OPLAN beschreibt, welche Aufgaben auf Deutschland im Falle einer Bündnisverteidigung zukommen, und welchen Unterstützungsbedarf es von Seiten der Hilfsorganisationen (HiOrgs) im Zivilschutz bedarf – ohne allerdings konkret zu werden. Kern dabei ist eine funktionierende zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ).
Mit den Worten unserer noch amtierenden Außenministerin Annalena Baerbock ausgedrückt: „Die Zeit des parasitären Pazifismus ist vorbei“. Es besteht also ein dringender Handlungsbedarf auf allen Ebenen unserer Gesellschaft, inkluskive der dem Zivilschutz verpflichteten HiOrgs.
Rolle der Hilfsorganisationen
Sollte der Bündnisverteidigungsfall ausgerufen werden, sind die HiOrgs (insbesondere JUH, MHD und DRK), neben ihren traditionellen Einsatzbereichen wie Rettungsdienst und Katastrophenschutz, zur Aufrechterhaltung des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung, auch zusätzlich im Zivilschutz gefordert.
Im Zivilschutz übernehmen die HiOrgs Aufgaben
- zum unmittelbaren Schutz der Bevölkerung vor Kriegseinwirkungen
- im Bereich Host-Nation-Support (HNS) zur Unterstützung alliierter Kräfte auf dem Marsch durch Deutschland
- bei der sanitätsdienstlichen Versorgung verwundeter Soldaten auf dem Weg zurück nach Deutschland, der Verteilung der Verwundeten in Deutschland und teilweise auch in der Rehabilitation von Verletzten und Verwundeten.
Zusätzlich ist davon auszugehen, dass Flüchtlingsbewegungen aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland stattfinden werden, auch hier sind die HiOrgs gefragt.
Die Aufrechterhaltung der Versorgungsqualität im Gesundheitswesen bei steigendem Bedarf durch einen Bündnisverteidigungsfall und dem damit erforderlichen Zivilschutz erfordert entweder eine Aufstockung von Ressourcen wie Personal, Material und Ausrüstung, eine Absenkung der Versorgungsstandards oder eine Kombination von beidem. Diese Entscheidung kann nur eine politische Entscheidung sein. Sie sollte entsprechend zeitnah entschieden, kommuniziert und umgesetzt werden. Sie ist das A und O, um den Bedarf auf Seiten der HiOrgs zu beziffern und zu klären, wie hoch der Unterschied zwischen erforderlichen und verfügbaren Ressourcen sein wird und welche Massnahmen zum Abbau der Mangellage erforderlich sind.
Neben den politisch zu lösenden rechtlichen und finanziellen Themen erscheint es wahrscheinlich, dass die ehrenamtlichen Helfer der Hilfsorganisationen nur ungern von ihren Arbeitgebern freigestellt werden. Anders als bei Katastrophenschutzeinsätzen, die zeitlich und räumlich begrenzt sind, erfordern Zivilschutzeinsätze längerfristiges Engagement, sowohl vor Ort aber auch bundes- bzw. europaweit. Entsprechend schwierig wird es sein, ausreichend gutes Personal, auch über einen längeren Zeitraum, im Zivilschutz zu verpflichten.
Diese und weitere Themen müssen aufgegriffen werden, um Lösungsansätze in enger Abstimmung aller Akteure zu entwickeln, und die erforderlichen Schlüsse und Konsequenzen zu ziehen.
Gehen wir ins Detail sehen wir vor allem drei Schwachstellen:
Zu wenig Personal
Ein zentrales Problem der Hilfsorganisationen ist der Mangel an Fachkräften und Ehrenamtlichen. Viele Helfer stehen aufgrund beruflicher oder persönlicher Verpflichtungen nur eingeschränkt zur Verfügung. Informierte Schätzungen – belastbare Zahlen liegen noch immer nicht vor – gehen davon aus, dass nur ca. 20% der Ehrenamtlichen im Bereich Katastrophen- und Zivilschutz im Falle einer Bündnisverteidigung zur Verfügung stehen. Lösungsansätze wie dieses Dilemma zeitnah behoben werden könnte, gibt es von Seiten der HiOrgs, die leider nicht geschlossen auftreten, derzeit nicht.
Eine Dienstpflicht – so umstritten sie auch sein mag – könnte einen Weg aus dem Personal-Dilemma aufzeigen. Ebenso wäre es sinnvoll, wenn alle Schüler bis zum 18. Lebensjahr eine Ausbildung z. B. zum „Rettungsdiensthelfer“ absolvieren würden. Dies erfordert lediglich vier Wochen und würde unsere Resilienz dramatisch stärken.
Veraltete Ausstattung und Digitalisierung
Die HiOrgs kämpfen mit teilweise veralteter Technik und unvollständiger Ausrüstung, zumal diese nicht für die aktuelle Bedrohungslage konzipiert wurde.
Unzureichende digitale Infrastruktur erschwert die Transparenz und das Miteinander. Digitale Lagebilder der HiOrgs basieren, sofern sie überhaupt auf Landes- und Bundesebene existieren, auf unterschiedlichen Systemen und lassen sich nicht aggregieren.
Es fehlt an zivilschutzfähigen Fahrzeugen und Kommunikationssystemen, die für effiziente Einsätze und die im OPLAN bislang definierten Aufgaben unerlässlich sind.
Finanzielle Engpässe
Die Finanzierung der Hilfsorganisationen basiert auf Spenden und staatlicher Unterstützung, die oft nicht ausreicht, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
Aus Sicht von Spendern ist nicht ersichtlich, warum Spenden für den Zivilschutz – immerhin die staatliche Aufgabe schlechthin – herangezogen werden sollten. Das Bundesministerium des Inneren, aber auch die entsprechenden Ministerien auf Landesebene sind hier in erster Linie gefragt, die erforderlichen Mittel zur Bewältigung der im Zivilschutz angesiedelten Aufgaben zur Verfügung zu stellen, und zwar nicht „nach Haushaltslage“ wie es in den vergangenen 30 Jahren immer wieder der Fall gewesen ist. Der von General Alfons Mais geprägte Satz: „Alles was wir jetzt nicht finanzieren, zahlen wir später in schwarzen Säcken“ (Anmerkung: Leichensäcken), trifft sicherlich auch auf die mangelnden Mittel im Zivilschutz zu.
Unzureichende Zusammenarbeit
Großlagen wie Hochwasser (2013), Flüchtlingskrise (2015) und Corona haben in Bayern gezeigt, wie effizient ein gemeinsamer Stab der HiOrgs auf Landesebene sein kann. Durch die enge Zusammenarbeit im Stab konnten die involvierten HiOrgs schneller gemeinsame Lösungen entwickeln. Lösungen die in dieser Art keiner der Akteure alleine hätte auf die Beine stellen können. Der seinerzeit etablierte Stab in Bayern wurde aber mittlerweile wieder deaktiviert, möglicherweise fühlten einige ihre Partikulärinteressen nicht entsprechend vertreten. Aktuell aber wäre ein solcher Stab, gerade auch als Ansprechpartner für die anderen Akteure des OPLAN auf Landes- und Bundesebene eine wesentliche Erleichterung. Gleichzeitig könnten Lösungen schneller entwickelt und angegangen werden.
Aufgrund einer nicht vorhandenen Finanzierung von Seiten des Bundes fehlen vielerorts die Führungskräfte und Stäbe auf Seiten der HiOrgs, um Aufgaben, Strukturen und Prozesse im Zivilschutzfall auf Ebene der Länder und des Bundes mit zu definieren.
Erschwerend kommt hinzu, dass die für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den anderen OPLAN-Akteuren erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen des Kernpersonals der HiOrgs noch nicht vorhanden sind. Was beim G7 Gipfel 2015 in Bayern seinerzeit sehr gut funktioniert und die Zusammenarbeit erst möglich gemacht hat, findet im Bereich Zivilschutz schlichtweg nicht statt. Auf Nachfragen erscheint es, als ob das BMI auch dieser Aufgabe keine genügende Bedeutung zuordnet.
Fazit
Die Hilfsorganisationen sind eine tragende Säule des deutschen Zivilschutzes und stehen vor wachsenden Herausforderungen. Eine enge Zusammenarbeit der HiOrgs untereinander, sowie eine enge Abstimmung der gemeinsamen Position mit BMI, BMVg und der Politik ist notwendig, um langfristige Finanzierungsmodelle, bessere Rahmenbedingungen und eine effektivere Koordination zu gewährleisten. Auf Ebene der Politik müssen endlich die erforderlichen Ressourcen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen ein „Dienstjahr“, um den personellen Engpässe auf allen Ebenen entgegenwirken zu können. Auf Ebene der Wirtschaft und Gesellschaft – hier sind wir alle gefragt – muss der Wille zur Resilienz gefördert bzw. gestärkt werden.
Nur so kann die gesundheitliche Versorgungsleistung der Bevölkerung und der Zivilschutz in Deutschland auf einem erstrebenswerten Niveau gesichert werden, nur so werden Bund und Länder ihrer Verantwortung gerecht, nur so werden wir es jemals hin zu einem resilienten Deutschland schaffen.
Autor: Alexander Graf von Gneisenau
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: