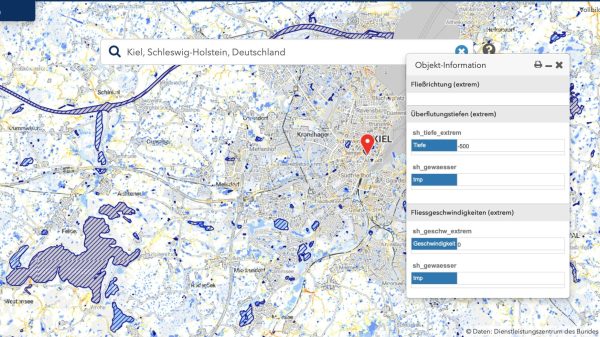Alexander Held ist studierter Forstwissenschaftler und Experte für Waldbrandprävention und -bekämpfung am European Forest Institute (EFI). Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn wurde er immer wieder mit mangelnder Kommunikation zwischen Fortwirtschaft, Feuerwehr und weiteren Katastrophenschutzeinheiten konfrontiert.
Das Interview führte Jessica Fuchs.
Die Prävention und Bekämpfung von Waldbränden ist ein Thema, das sowohl den Forstbereich als auch die Feuerwehr betrifft. Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit in diesem Kontext ein?
Ein Erlebnis veranschaulicht für mich die bestehende Problematik sehr gut: Während eines Hotelaufenthalts saß ich beim Frühstück zufällig neben einem Tisch, an dem Mitarbeiter eines Bundesministeriums das Thema Waldbrand diskutierten. Schließlich kamen sie zu dem Schluss, dass dieses Thema am besten bei der Feuerwehr aufgehoben sei.
Doch der Begriff lautet „Waldbrand“, nicht „Feuerwehrbrand“. Selbst für Laien sollte eigentlich ersichtlich sein, dass Förster und Feuerwehr eng zusammenarbeiten müssen – idealerweise sogar der gesamte Forstsektor in Verbindung mit der Landwirtschaft, dem Tourismus und dem Naturschutz. Diese Akteure sollten das Thema Feuer aktiv in ihre Planungen einbeziehen. So wie Förster täglich den Borkenkäfer im Blick haben, sollte auch der Umgang mit Feuer und Waldbrand ein integraler Bestandteil ihres Arbeitsalltags sein.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind eindeutig: „Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob es zu Bränden kommt, sondern nur noch wann und mit welcher Intensität.“ Dieses „Wann“ und „Wie“ können wir durch gezielte Maßnahmen beeinflussen – durch optimierte Forstwirtschaft, präventive Maßnahmen, strategische Planung, gemeinsame Übungen sowie eine verbesserte Koordination und Nutzung von Synergien.
Gibt es bereits Fortschritte in diesem Bereich?
In den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich im Feuerwehrwesen einiges verändert. Die Wahrnehmung der Feuerwehr gegenüber Waldbränden hat sich deutlich gewandelt. Ich erinnere mich an die Zeit nach meiner Tätigkeit in Südafrika: Als ich nach Deutschland zurückkehrte, wollte ich mein Wissen über Waldbrände weitergeben. Doch die Reaktionen waren ablehnend – nach dem Motto: „Wir sind die Feuerwehr, was willst du uns erzählen?“
Heute ist die Situation eine völlig andere. Die Feuerwehr hat erkannt, dass Waldbrandbekämpfung mit der vorhandenen Ausrüstung, Technik und Ausbildung oft nur begrenzt möglich ist. Diese Erkenntnis war sicherlich nicht einfach, da die Feuerwehr grundsätzlich sehr breit aufgestellt ist – von der Errichtung eines Maibaums über die Rettung bei Autounfällen bis hin zur Bekämpfung von Keller- und Chemiebränden. Doch bei Waldbränden stieß man mit der bisherigen Ausstattung an Grenzen.
Im Vergleich zum Forstbereich hat die Feuerwehr jedoch schneller auf diese Herausforderungen reagiert: Neue Ausrüstung wurde beschafft und es existiert mittlerweile ein erster nationaler Standard für die Waldbrandausbildung – auch wenn dieser noch nicht vollkommen ausgereift ist.
In der Forstwirtschaft ist das Thema Waldbrand ebenfalls angekommen, insbesondere in Brandenburg. Dort ist Waldbrandprävention ebenso präsent wie der Borkenkäfer im Schwarzwald. Allerdings ist das Bewusstsein in vielen anderen Bundesländern noch nicht ausreichend ausgeprägt. Viele Förster und Waldbesitzer hoffen weiterhin darauf, dass es sie nicht trifft – und im Falle eines Brandes die Feuerwehr eingreift.
Dies zeigt, dass in Teilen der Forstwirtschaft ein grundlegendes Verständnis für Waldbrandprävention fehlt. Häufig beschränkt sich die Vorbereitung auf gut ausgebaute Waldwege für die Feuerwehr und zugängliche Tiefbrunnen als Wasserquelle. Dies ist jedoch keine Prävention, sondern lediglich eine Einsatzvorbereitung. Das Thema wurde in der forstlichen Ausbildung bislang nicht systematisch vermittelt. Dabei sollte vielmehr gefragt werden: Welche waldbaulichen Maßnahmen tragen zur Brandverhütung bei? Welche strukturellen Anpassungen sind langfristig oder kurzfristig notwendig?
Kurzfristig könnten beispielsweise Wundlinien das Brandgeschehen eindämmen, während ein höherer Anteil an Laubholz langfristig das Brandrisiko reduziert. Leider fehlt es vielerorts an Wissen und strukturellen Verantwortlichkeiten. Häufig wird das Thema Waldbrandprävention lediglich als Zusatzaufgabe einem einzelnen Förster übertragen, ohne ausreichende finanzielle oder personelle Unterstützung. Fortbildungen im Ausland sind oft nicht finanzierbar, ebenso wenig wie die notwendige Ausrüstung. Zudem bleibt die Bearbeitung dieser Thematik eine Zusatzaufgabe, die im bestehenden, ohnehin begrenzten Arbeitszeitkontingent erledigt werden soll – unter diesen Bedingungen ist nachhaltiger Fortschritt kaum möglich.
Wie kann dieser Zustand verbessert werden?
Politisch muss sich in diesem Bereich einiges ändern. Waldbrände sollten nicht wie Sturmereignisse, Hochwasser oder Erdbeben betrachtet werden – denn im Gegensatz zu diesen Naturkatastrophen lassen sich Feuer durch Prävention und gezielte Maßnahmen aktiv beeinflussen. Es fehlt jedoch an einem langfristigen politischen Rahmen, verbindlichen Vorgaben und strukturellen Förderungen.
Auch ich erlebe diese Problematik in meiner Arbeit am European Forest Institute. Wir initiieren regelmäßig vielversprechende Forschungsprojekte zur Waldbrandprävention, doch nach wenigen Jahren läuft die Finanzierung aus. Es wirkt, als sei das Problem nach Ablauf einer Förderperiode gelöst – dabei bedarf es kontinuierlicher Forschung und Umsetzung.
Gibt es politische Bemühungen zur Verbesserung der Waldbrandprävention?
Bislang hat das Thema in Politik und Gesellschaft keine breite Verankerung gefunden – es wird meist nur dann diskutiert, wenn es bereits zu Bränden gekommen ist. Eine langfristige Strategie für Deutschland existiert nicht. Auf Bundesebene ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als föderale Institution zuständig. Dort wurden Konzepte für europäische Waldbrandmodule entwickelt: In Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern wurden Waldbrandzüge zusammengestellt, die im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzmechanismus bei Bedarf ins Ausland entsendet werden – beispielsweise nach Griechenland oder Portugal.
Während dieser Ansatz auf föderaler Ebene funktioniert, gibt es auf nationaler Ebene erhebliche Defizite. Deutschland verfügt kaum über praktische Erfahrung im Bereich der Waldbrandbekämpfung und besitzt nur unzureichende Ausrüstung. Dennoch wird bereits der übernächste Schritt vollzogen, indem internationale Einsatzmodule aufgebaut werden – obwohl die eigene Infrastruktur und Expertise noch nicht ausreichend entwickelt sind.
Dies verdeutlicht ein zentrales Problem: In manchen Bereichen gibt es positive Entwicklungen, während an anderer Stelle wenig Fortschritt erkennbar ist. Brandschutz ist in Deutschland Ländersache, die Feuerwehr ist kommunal organisiert – und am Ende führt die föderale Struktur häufig dazu, dass sich Verantwortlichkeiten zersplittern und keine einheitlichen Lösungen gefunden werden.
Wie könnte eine effektive politische Strategie aussehen?
Auf Bundesebene müsste klar definiert werden, dass Waldbrandprävention eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Die bestehenden Wissenslücken – sowohl in der Forstwirtschaft als auch bei der Feuerwehr – sind erheblich. Daher wäre die Einrichtung eines nationalen Kompetenzzentrums sinnvoll. Eine zentrale Anlaufstelle könnte Informationen zu Ausbildung, internationalem Austausch, Ausrüstung, waldbaulicher Prävention und Brandnachsorge bereitstellen.
Am European Forest Institute haben wir im Rahmen eines Forschungsprojekts bewiesen, dass ein solches Modell funktionieren kann. Unser dreijähriges Projekt zur Waldbrand-Klima-Resilienz diente als „One-Stop-Shop“ mit Modulen zu Ausbildung, Ausrüstung und Fortbildungsmöglichkeiten. Es war äußerst erfolgreich – wurde jedoch nach Ablauf der Förderperiode eingestellt.
Die finanzielle Dimension ist dabei bemerkenswert: Während der Projektlaufzeit betrug das Budget lediglich 0,03 Euro pro Hektar deutscher Waldfläche – und dennoch konnten wir ein effektives Angebot aufbauen. Dieses Geld sei angeblich nicht verfügbar, doch wenn es tatsächlich brennt, werden kurzfristig hohe Summen bereitgestellt – oft ohne strategischen Plan.
Dabei existieren bereits innovative technische Lösungen für die Brandprävention, etwa Satellitenüberwachung oder Drohnensysteme zur Früherkennung (wir berichteten: Waldbrandgefahr: Mit weniger Wasser effektiver löschen). Doch häufig fehlt das Wissen über diese Möglichkeiten – sowohl in der Feuerwehr als auch in der Forstwirtschaft und der Politik. Eine stärkere interdisziplinäre Vernetzung wäre daher essenziell, um nachhaltige Strategien zur Waldbrandprävention und -bekämpfung zu etablieren.
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: