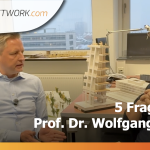Die aktuelle geopolitische Lage hat auch zur Steigerung der Gefahr für terroristische Anschläge in Deutschland geführt. Die Bundesregierung betont in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie die Bedeutung des Katastrophenschutzes und der Terrorabwehr. Aufgrund der angespannten geopolitischen Lage wird auch mit asymmetrischen Bedrohungsszenarien gerechnet. Krankenhäuser gelten als kritische Infrastrukturen und sind nach § 5 LKatSG verpflichtet, ihre Einsatzfähigkeit bei Katastrophen sicherzustellen. Nach § 28 Abs. 2 LKHG Baden-Württemberg müssen sie durch Alarm- und Einsatzpläne eine Versorgung auch bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV) gewährleisten – auch bei Terror- und Amoklagen, die unter dem Begriff „lebensbedrohliche Einsatzlagen“ (LebEL) zusammengefasst werden.
Neben dem üblichen Informationsfluss (ILS ↔ Klinik) ist ein direkter Kommunikationskanal zur Polizei erforderlich. Idealerweise findet dieser vor Ort persönlich zwischen Polizeiführung, Leitendem Notarzt (LNA) und Klinikverantwortlichen statt. Rückfallebenen (z. B. Treffpunkt bei Netzausfall) sind im Vorfeld festzulegen.
Für einen strukturierten Austausch sind zwei Ebenen erforderlich:
- Stabsebene: Polizei ↔ LNA mit Stabsqualifikation
- Führungsebene: Gemeinsame Einsatzleitung vor Ort
Größere Kliniken (z. B. überregionale Traumazentren) sollten einen hauptamtlichen Katastrophenschutzbeauftragten benennen. In kleineren Häusern kann diese Funktion auch nebenamtlich wahrgenommen werden – jedoch mit klarer Aufgabenbeschreibung. Risikoanalysen, Alarmplanpflege und Übungsplanung erfordern personelle und zeitliche Ressourcen und können nebenamtlich allerdings nur bedingt umgesetzt werden.
Viele Kliniken verfügen derzeit weder personell noch baulich über ausreichende Schutzmaßnahmen gegen gewaltbereite Täter.
Jede Klinik sollte ein standortspezifisches Sicherheitskonzept entwickeln, das bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen integriert.
Die lokale Sicherheitskonferenz sollte Sicherheitslücken identifizieren und gemeinsam mit den zuständigen Stellen geeignete Maßnahmen planen.
Ein eigener Sicherheitsdienst mit flexiblen Einsatzkapazitäten ist essenziell, insbesondere für den Schutz kritischer Klinikbereiche wie Notaufnahme oder Sichtungsstelle.
Die Polizei kann den Schutz der Klinik (z. B. Zugangskontrolle, Schutz der Rettungswege) unterstützen – je nach Lage und Verfügbarkeit. Die Zusammenarbeit mit dem klinikeigenen Sicherheitsdienst muss abgestimmt erfolgen.
Die internationale Sicherheitslage zeigt, dass Kliniken potenzielle Zielobjekte sind. Dennoch existieren in vielen Häusern kaum Schutzkonzepte. Befragungen belegen: Nur rund ein Drittel der Kliniken berücksichtigen terroristische Szenarien in ihren Einsatzplänen – und noch weniger führen entsprechende Übungen durch. Es besteht dringender Handlungsbedarf.
Ein modular aufgebautes, abgestimmtes Aus- und Fortbildungskonzept für Polizei, Rettungsdienste und Kliniken wird empfohlen. Regelmäßige, praxisnahe Schulungen – idealerweise mit Referenten aus verschiedenen Organisationen – verbessern das Verständnis füreinander und fördern die Zusammenarbeit.
Insbesondere interdisziplinäre Übungen sind essenziell, um Abläufe zu testen und Schwachstellen zu identifizieren. Die Planung dieser Übungen sollte über die Sicherheitskonferenz erfolgen.
Kompetenzbasierte Trainingsmodelle haben sich national und international bewährt. Sie fördern nicht nur Fachwissen, sondern auch Entscheidungs- und Handlungskompetenz im Einsatz. Derzeit fehlen jedoch verbindliche Standards für die Katastrophenausbildung im klinischen Bereich, vor allem an der Schnittstelle zwischen Präklinik und Klinik. Übungen mit realitätsnahen Szenarien sind notwendig, um Strukturen zu stärken und den Ernstfall zu trainieren.
- Erforderlich sind kompetenzbasierte Schnittstellenlösungen, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Präklinik und Klinik bei der Versorgung von Patienten nach einer LebEL-Lage sicherzustellen.
- Für die Einsatzvorbereitung wird empfohlen, eine lokale Sicherheitskonferenz auf Landkreisebene bzw. bei der unteren Katastrophenschutzbehörde einzurichten. Teilnehmende sollten Vertreter*innen der unteren Katastrophenschutzbehörde, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Leitender Notarzt sowie die Katastrophenschutzbeauftragten der betroffenen Kliniken sein.
- In der polizeilichen Einsatzleitung im Führungs- und Lagezentrum der Polizei (FLZ) sollten Verbindungspersonen in von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz vertreten sein. Dies ermöglicht eine effektive und zeitnahe Einsatzkoordination. Von dort aus sollte ein verbindlicher Informationsfluss an die Kliniken durch benannte Ansprechpartner sichergestellt werden.
- Regelmäßige Übungen sind unverzichtbar, insbesondere interdisziplinäre und organisationsübergreifende Trainings. Die Planung solcher Übungen ist eine zentrale Aufgabe der lokalen Sicherheitskonferenz.
Autoren: Priv.-Doz. Dr. med. Thorsten Hammer und Dr. med. Stefan Weiß
Erstmals erschienen in: Crisis Prevention 2/2025
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: