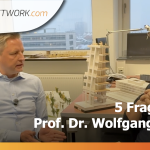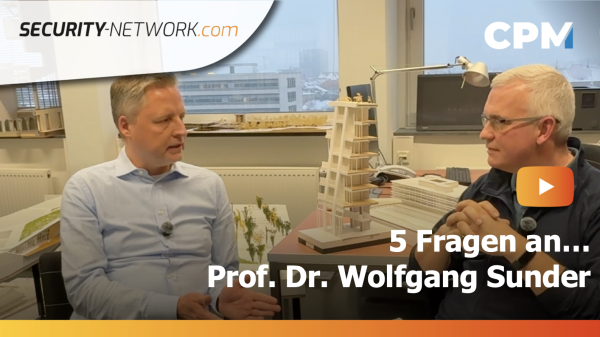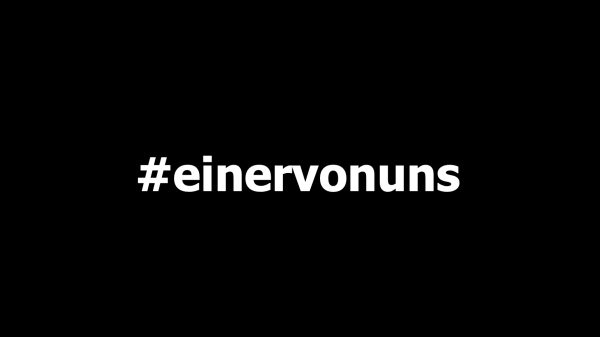Mit der Zunahme von Katastrophen ist auch die Notwendigkeit von Vorgaben zur medizinischen Versorgung von dabei anfallenden Katastrophenopfern gegeben. Bisher beruhten medizinische Empfehlungen dazu auf der Basis von Erfahrung einzelner Experten und Institutionen. Die Konsequenz waren unterschiedliche Vorgehensweisen und differente Handlungsempfehlungen. Nunmehr hat sich die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) zur Aufgabe gemacht eine konsentierte Leitlinie zu erstellen.
Die AWMF bündelt die Interessen der medizinischen Wissenschaft und beschäftigt sich mit fachübergreifenden Fragestellungen in der wissenschaftlichen Medizin, fördert die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder bei der Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben und Ziele sowie den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die ärztliche Praxis. Sie ist der Dachverband von 183 Fachverbänden und koordiniert die Entwicklung von medizinischen Leitlinien für Diagnostik und Therapie und vertritt diese gegenüber den damit befassten Institutionen.
Seit 2022 existiert für Deutschland nunmehr eine Leitlinie, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI e.V.) in Zusammenarbeit mit der Klinik für Anästhesiologie, Kompetenzzentrum für medizinischen Bevölkerungsschutz der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Die Leitlinie „Katastrophenmedizinische prähospitale Behandlungsleitlinien“ als S2k-Leitlinie (= konsensbasierte Leitlinie, die einen strukturierten Prozess der Konsensfindung durchlaufen hat) veröffentlicht.
Beteiligt waren insgesamt 18 medizinische Fachgesellschaften, 9 Organisationen mit Bezug zur Katastrophenmedizin und 14 Experten. Um der Besonderheit der einer interdisziplinären und interprofessionellen Leitlinienentwicklung Rechnung zu tragen, war auch die Zusammenarbeit mit Vertretern der Hilfsorganisationen, der Feuerwehr der Bundeswehr, der Bundespolizei und des öffentlichen Gesundheitsdienstes gewährleistet.
Die Leitlinien beschreiben nicht vordergründig den organisatorischen Ablauf der Bewältigung einer Katastrophe, sondern die medizinische Versorgung einzelner Katastrophenopfer bei zerstörter Infrastruktur in Konkurrenz zu einer Vielzahl von Verletzten und Erkrankten. Auch geht die Leitlinien nicht auf Rahmenbedingungen wie z.B. Einsatzstellenabsicherung oder Raumordnung ein. Es geht vielmehr um den Bereich der Kata-
strophenmedizin.
Definition der Katastrophenmedizin
Schon in der Vergangenheit gab es verschiedene Definitionen des Bereiches der medizinischen Versorgung von Katastrophenopfern (z.B. DIN 13050, BBK, WHO), weshalb eine einheitliche und konsentierte Neufassung erforderlich wurde. Es sollten möglichst umfassend Einfluss -und Umgebungsfaktoren einfließen. Unter Katastrophenmedizin wurde die medizinische Versorgung in Katastrophen oder Großschadensereignissen mit Mangel an Ressourcen (personell und/oder materiell) und nicht nutzbarer Infrastruktur verstanden, bei der von der Individualmedizin abgewichen wird, um das bestmögliche Behandlungsziel für die größtmögliche Anzahl von Patienten zu erreichen.
Inhalt und Umfang
Das Leitlinienwerk enthält auf 226 Seiten in 12 Kapiteln schwerpunktmäßig zu verschiedenen Schädigungen (Be-)Handlungshinweise. Das medizinische Versorgungsniveau und der Versorgungsumfang orientieren sich weniger am ursächlichen Szenario als vielmehr an der Verfügbarkeit von Ressourcen und dem Schwerpunkt der behandlungsbedürftigen Symptome, den Verletzungen und Erkrankungen sowie am Ausmaß der Infrastrukturschädigung.
Wesentliche Schwerpunkte der Leitlinie sind Ausführungen zu traumatisch-thermische Verletzungen, die Behandlung bei chemischer Kontamination und die Integration von psychosozialer Notfallversorgung. Weichteil- und Hautverletzungen sowie Atemprobleme sind die am meisten beschriebenen Behandlungsursachen. An dritter Stelle folgen Extremitätenverletzungen bzw. muskuloskelletale Verletzungen. Danach folgen kardiale und neurologische Beschwerdebilder sowie psychische und mentale Erkrankungen oder Symptome und nicht-übertragbare Erkrankungen.
Bei der Umsetzung der Behandlungsempfehlungen wird auf die bekannten Verfahrensweisen aus der Notfallmedizin zurückgegriffen. Dies beinhaltet z.B. das Anwenden des X-ABCDE-Schemas. Dieses wird nicht ausschließlich auf lebensrettende Maßnahmen aus der Erstuntersuchung („Primary survey“) bezogen, sondern auch auf weiterführende medizinische Behandlungsmaßnahmen.
Die Behandlung von Verletzungen ist unterteilt in solche für Extremitätentraumata, Weichteil- und Brandverletzungen. Das Schädel-Hirn-Trauma findet sich ebenso wie die Thorax- und Wirbelsäulenverletzungen unter den Empfehlungen.
Ein eigenes Kapitel ist der Behandlung der chemischen Kontamination gewidmet. Die medizinische Lagebeurteilung dabei sollte unter besonderer Beachtung und Erkennung von Toxidromen maßgeblich zur Einschätzung der Gefahrenlage beitragen. Bei Verdacht oder Nachweis einer chemischen Gefahrenlage kommt der Dekontamination die führende Bedeutung zu. Die Dekontamination sollte so zeit- und ortsnah wie möglich durchgeführt werden, um eine Kontaminationsverschleppung zu reduzieren.
Lebensrettende Sofortmaßnahmen werden unverzüglich eventuell auch innerhalb des Gefahrenbereiches unter besonderer Beachtung des Eigenschutzes (Schutzkleidung) durchgeführt. Am Deko-Platz sollte dann die Reihenfolge der Versorgung und der Dekontamination festgelegt werden. Eine schnellstmögliche Antidotgabe ist für die Eingrenzung der Schädigung notwendig.
Neben konkreten medizinischen Therapiemaßnahmen werden in der Leitlinie auch psychosoziale Hilfeleistungen beschrieben mit dem Ziel, eine psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) zu integrieren und psychische Belastungen exponierter Personen und Einsatzkräfte zu reduzieren. Die PSNV hat sich inzwischen bei einer Katastrophe und einem Großschadensereignis als essentieller Bestandteil etabliert.
Schließlich wird in dem Kapitel Ethik das Problem der Pflichtenkollision gegenüber mehreren Patienten angesprochen, die alle gleich dringlich behandelt werden müssen, aber aufgrund des Ressourcenmangels (Zeit, Personal, Material) nicht gleichzeitig und nicht auf gleichem Niveau behandelt werden können. Als Entscheidungskriterium ist vordergründig die medizinische Notwendigkeit und nicht die medizinische Prognose oder die klinische Erfolgswahrscheinlichkeit heranzuziehen.
Als ethische Grundlagen werden die Besonderheiten des Umgangs mit der Patientenautonomie im K-fall, die zentrale Rolle der Indikationsstellung vor allem in ihrer Bedeutung für die Ressourcenverteilung mit den Dimensionen der Verfahrensgerechtigkeit und Fairness einerseits, sowie der Sichtung als eigentliches Verfahren der Allokation andererseits herangezogen.
Patienten ohne Überlebenschance soll eine palliative Symptomenkontrolle und bei Patienten mit Kreislaufstillstand sollten keine Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden. Bei dieser Vorgehensweise können Ärzte und Einsatzpersonal auch rechtlich nicht belangt werden, wenn sie es nicht schaffen, alle behandlungsbedürftigen Patienten adäquat zu versorgen, sondern priorisieren müssen. Bei der Priorisierung ist darauf zu achten, dass Patienten nicht aufgrund von Gruppenzugehörigkeit diskremisiert werden, in dem sie zurückgestellt oder von einer Behandlung ausgeschlossen werden.
Sichtung
Die Sichtung ist ein zentrales Element in dem Versorgungskonzept bei Großschadensfällen und Katastrophen, wenn eine Diskrepanz zwischen Versorgungsnotwendigkeit und Versorgungskapazitäten besteht (4). Für die schnelle und zielgerichtete Behandlung von Patienten ist eine Identifikation derjenigen notwendig, die am meisten von einer sofortigen Therapie profitieren. Die Sichtung setzt sich aus verschiedenen Prozessschritten zusammen: Ersteinschätzung, Vorsichtung (für geschulte Rettungskräfte) und ärztliche Sichtung.
Nach Eintreffen am Schadensort erfolgt eine Ersteinschätzung der Lage für die taktische Gefährdungsbeurteilung im Sinne des Eigenschutzes. Nach ungefährer Abschätzung der Zahl der Patienten und Betroffenen resultieren mögliche Schwerpunkte für den Einsatz. Die anschließende initiale Vorsichtung bei Erstkontakt mit medizinischen Fachkräften umfasst eine medizinische Bewertung des zum Zeitpunkt der Sichtung aktuellen Patientenzustandes. Nach der ärztlichen Sichtung wird die medizinische Behandlung organisiert. Die Durchführung der (ärztlichen) Sichtung erfolgt nach einem Standard (Algorithmus). Die Konsequenz ist eine Priorisierung der Behandlung und der Verteilung von Ressourcen.
Fazit
Ziel der Leitlinie ist es, Einsatzkräfte besser auf die Ausnahmesituation einer Katastrophe vorzubereiten und ihnen praktikable Handreichungen zu geben, um den Betroffenen Überlebens- und Genesungschancen zu geben. Die Empfehlungen geben dafür Vorgaben für das medizinische Vorgehen, die sich auf eine präklinische Versorgung von bis zu 72 Stunden nach Eintritt des Schadensereignisses beziehen. Die Anzahl vermeidbarer Todesfälle in Katastrophenlage dadurch soll minimiert und eine Lebensrettung mit bestmöglichem Behandlungsergebnis gefördert werden. Die Leitlinie basiert auf nationalen und internationalen Erkenntnissen und Erfahrungen von Experten unterschiedlicher Berufsgruppen und Fachdisziplinen und kann somit auch einen Beitrag zur Einsatzplanung, -vorbereitung, -durchführung und –nachbereitung leisten.
Autor: Prof. Dr. med. Peter Sefrin
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: