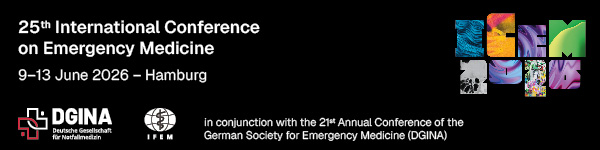Sommer, Wasserrettung, DLRG – drei Begriffe, die gut zusammenpassen. Wir haben beim 1. Vorsitzenden der DLRG-Ortsgruppe Merzig im saarländischen Landkreis Merzig-Wadern nachgefragt, wie man Rettungsschwimmer bei der DLRG werden kann und wie der sommerliche Alltag in diesem Ehrenamt aussieht. Leonhard Hoffmann macht im Gespräch deutlich: Die Ehrenamtlichen der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft brauchen in der breiten Masse viel mehr Sichtbarkeit.
Die Fragen stellte Jessica Fuchs.
Wie viele Menschen beteiligen sich in eurer Region an der Wasserrettung?
Wir, die DLRG-Ortsgruppe Merzig e.V., sind im Landkreis Merzig-Wadern mit rund 100.000 Einwohnern im Bereich der Wasserrettung aktiv. Unsere Ortsgruppe hat aktuell etwa 650 Mitglieder. Wir sind die einzige DLRG-Ortsgruppe im Landkreis, die sowohl im Katastrophenschutz als auch mit einer Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) vertreten ist. Von den 650 Mitgliedern sind 25 aktiv in der SEG eingebunden, wobei im Katastrophenschutz rund 50 Rettungsschwimmer aktiv werden können.
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um Rettungsschwimmer zu werden?
Um im Bereich der Wasserrettung aktiv tätig zu sein, benötigt man mindestens das Rettungsschwimmabzeichen Silber. Dieses ist Voraussetzung für weitere Lehrgänge im Bereich Wasserrettung und bildet die Grundlage. Körperliche Fitness ist die Mindestvoraussetzung, da nur ein geübter Schwimmer anderen helfen kann ohne sich selbst zu gefährden. Eine zusätzliche Ausbildung in der Ersten-Hilfe ist ebenso Lehrgangsvoraussetzung.
Die Fachausbildung Wasserrettungsdienst ist die Basisausbildung für alle Einsatzbereiche der DLRG. Ab dem 16. Lebensjahr können Rettungsschwimmer nach Absolvierung der Rettungsschwimm-Ausbildung die Prüfung zum Wasserretter ablegen. Darauf aufbauend sind Spezialisierungen möglich – etwa als Wachführer, Bootsführer, Einsatztaucher, Strömungsretter oder im Katastrophenschutz. So wächst man Schritt für Schritt in die Einsatzpraxis hinein.
Wie sieht der Alltag als Wasserretter im Sommer aus?
Man unterscheidet zwischen stationärem und mobilem Wasserrettungsdienst:
- Stationär: etwa an Wasserrettungsstationen, Badeseen oder an der Küste. Hier überwachen Wasserretter die Badebereiche und sichern Besucher ab.
- Mobil: im Rahmen des Katastrophenschutzes oder bei Einsätzen auf Anforderung der Behörden. Hier rücken Spezialeinheiten wie die SEG mit Strömungsrettern und Booten zur Suche und Rettung in Not geratener Menschen aus.
Ein typischer Tag am Losheimer Stausee, den die DLRG Merzig in den Sommerferien täglich und an Wochenenden absichert, beginnt mit der Kontrolle der Rettungsgeräte, Boote und Sanitätsmaterialien. Danach folgt eine Lagebesprechung zu Wetter und Wasserstand.
Im Laufe des Tages überwachen Wachgänger den See vom Ufer und vom Boot aus, leisten Erste Hilfe, retten Menschen aus Gefahrensituationen und üben regelmäßig, um ihre Fähigkeiten frisch zu halten. Abends wird die Ausrüstung gereinigt, überprüft und für den nächsten Tag vorbereitet.
Welche Arten von Unfällen beobachtet ihr im Sommer wie häufig?
Besonders oft beobachten wir Selbstüberschätzung und Leichtsinn: Menschen gehen ins Wasser, obwohl sie kaum schwimmen können, oder überschätzen ihre Kräfte. Ein Krampf oder Erschöpfung können dann schnell lebensgefährlich werden.
Auch unbeaufsichtigte Kinder sind eine häufig auftretende Gefahr – ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit genügt.
Hinzu kommt: Immer mehr Veranstaltungen oder Lokale suchen die Nähe zum Wasser. Leider führt das dazu, dass Personen ins Wasser fallen oder die Gefahr des Wassers bei Nacht nicht erkennen.
Im Mai 2025 erhielt unter anderem die DLRG-Ortsgruppe Merzig neue Strömungsretter-Ausstattung. Das Security Network war damals vor Ort dabei.
In NRW wird gerade über ein umfassendes Badeverbot im Rhein diskutiert. Wie sieht es mit der Saar aus?
Das Schwimmen in der Saar ist grundsätzlich verboten.
Die Saar wirkt ruhig, ist aber hochgefährlich. Strömungen, Sogwirkungen durch Frachtschiffe und Verwirbelungen unter der Oberfläche können selbst geübte Schwimmer überwältigen. Besonders riskant sind Staubereiche und Schleusen – selbst wenn die Wehranlagen mehrere Kilometer entfernt sind, reicht die Sogwirkung bei niedrigem Wasserstand noch bis in weit entfernte Flussabschnitte.
Zusätzlich bestehen hygienische Risiken: bakterielle Belastungen und Blaualgen nach Hitzeperioden können Erkrankungen auslösen.
Das Baden in der Saar ist daher lebensgefährlich!
Was sollten Menschen über das Baden in natürlichen Gewässern wissen?
Beim Baden in natürlichen Gewässern gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, die man nicht unterschätzen sollte. Anders als im Schwimmbad ist das Wasser häufig deutlich kälter, was schnell zu einem Kälteschock, Krämpfen oder Kreislaufproblemen führen kann.
In Flüssen oder im Meer bestehen unsichtbare Strömungen und Strudel, die selbst gute Schwimmer mitreißen können. Die Beschaffenheit des Untergrunds ist meist unklar: Steine, Äste oder plötzliche Tiefen bergen Gefahren, deshalb sollte man niemals kopfüber in unbekanntes Wasser springen. Auch die Wasserqualität ist nicht immer unbedenklich, weshalb nur an freigegebenen Badestellen geschwommen werden sollte.
Zudem gibt es in offenen Gewässern keinen Beckenrand, an dem man sich festhalten kann. Entfernungen wirken kürzer als sie tatsächlich sind und die eigenen Kräfte lassen schneller nach.
Auch das Wetter spielt eine große Rolle: Bei Gewitter muss man sofort das Wasser verlassen, da Blitzeinschläge lebensgefährlich sind, und auch Wind oder Wellen können die Situation gefährlich machen. Alkohol sollte beim Baden grundsätzlich tabu sein, da er die Reaktionsfähigkeit einschränkt und zu Selbstüberschätzung führt.
Besonders wichtig ist, niemals alleine schwimmen zu gehen. Wer in Gesellschaft badet, kann im Notfall schnell Hilfe holen oder leisten.
Kurz gesagt: Natürliche Gewässer sind unberechenbar. Wer dort schwimmt, sollte vorsichtig sein, sich nicht überschätzen und stets auf die eigene Sicherheit und die der anderen achten.
Das Baden im Schwimmbad ist sicherlich auch nicht ganz gefahrenfrei. Was sollte dort beachtet werden?
Auch im Schwimmbad gibt es Gefahren: Strömungskanäle, Sprudelanlagen oder Rutschen können Nichtschwimmer unter Wasser ziehen. In Erlebnisbädern kann es zu einer erhöhten Verletzungsgefahr durch Wellenbecken kommen. Ertrinken ist ebenfalls bereits bei niedriger Wassertiefe möglich. Hier ist gegenseitige Rücksichtnahme und Achtung unerlässlich. Auch Hygiene ist ein Thema – besonders bei hoher Besucherzahl.
Ernstfall Badeunfall: Wie geht ihr vor und welche Materialien werden benötigt?
Bei einem Badeunfall erfolgt zunächst die Alarmierung über die Notrufnummer 112. Die Leitstelle bewertet die Situation anhand einer strukturierten Notrufabfrage und entscheidet, welche Einheiten alarmiert werden: unsere DLRG-Ortsgruppe, die Feuerwehr, der Rettungsdienst und je nach Lage weitere Hilfsorganisationen.
Zeitgleich werden unsere Einsatzkräfte über Funkmelder alarmiert. Sobald sie das Vereinsheim erreichen, beginnt die schnelle Einsatzvorbereitung: Zunächst ziehen sie ihre persönliche Schutzausrüstung an, dazu gehören Trockenanzüge, Helme, Schwimmwesten und gegebenenfalls spezielle Rettungshandschuhe. Anschließend werden die Fahrzeuge mit dem für die jeweilige Einsatzlage und den Gewässertyp passenden Material beladen.
Für größere, fließende Gewässer wie Saar oder Mosel sowie Badeseen steht ein Motorrettungsboot bereit, das mit Funk, Rettungsbojen, Leinen, Navigationsmitteln und spezialisierter Sonartechnik ausgestattet ist. Für kleinere Seen oder flache Bereiche wird ein Inflatable Rescue Boat (IRB) genutzt, das schnell einsatzbereit, wendig und leicht transportierbar ist.
Für die Unterwassersuche kommt ein Side-Scan-Sonar zum Einsatz, das hochauflösende Bilder des Gewässergrunds liefert, während das tragbare Sonarsystem AquaEye mit KI-gestützter Objekterkennung die schnelle Lokalisierung vermisster Personen unter Wasser über große Flächen ermöglicht.
Zusätzlich steht der Strömungsretter-Anhänger bereit, der spezialisierte Ausrüstung für Flüsse und Hochwasser enthält, darunter Neoprenanzüge, Kletter- und Seiltechnik, Rettungslampen, Sicherungsmaterial und weitere persönliche Schutzausrüstung.
Während der Anfahrt zum Einsatzort findet bereits eine Lagebesprechung statt. Unser Einheitenführer steht in ständigem Kontakt mit der Leitstelle und der Einsatzleitung vor Ort, um aktuelle Informationen zu erhalten: die Lage der Betroffenen, Anfahrtswege, Aufgabenverteilung, Strömungsverhältnisse, Wetterbedingungen, Gefahr durch Treibgut oder Informationen über den Verkehr auf dem Gewässer.
Am Einsatzort erkundet unser Einheitenführer die Situation und berät die Einsatzleitung über die Möglichkeiten der DLRG-Wasserrettung: Sie beurteilen Gefahren für die Einsatzkräfte, die Position und Anzahl der Betroffenen und die geeigneten Rettungsmittel.
Je nach Lage werden Rettungstechniken ausgewählt: direkte Wasserrettung als schwimmerischer Einsatz, Einsatz vom Boot, seilunterstützte Bergung oder Unterwassersuche mit Sonar/AquaEye. Parallel rüsten sich die Einsatzkräfte für die vorgesehenen Rettungsmaßnahmen aus.
Die eigentliche Rettung erfolgt nach einem klar strukturierten Plan: Priorisierung von Gefährdeten, Absicherung der Einsatzkräfte, Rettung aus dem Wasser oder aus unzugänglichen Bereichen, Stabilisierung der Betroffenen und Übergabe an den Rettungsdienst.
Nach Abschluss des Einsatzes werden alle Gerätschaften gereinigt, gewartet und überprüft, Boote und Ausrüstung wieder einsatzbereit verstaut. In einer Einsatznachbesprechung werden Erfahrungen ausgetauscht, Verbesserungen diskutiert und die Einsatzbereitschaft für zukünftige Einsätze sichergestellt.
Zum Abschluss: Was wissen viele Menschen über eure Arbeit nicht?
Wenn überhaupt kennen viele die DLRG nur von Schwimmkursen oder vom Badesee. Wenige wissen, dass wir:
- ein wichtiger Teil des Katastrophenschutzes sind,
- eine sehr umfangreiche Ausbildung absolvieren (Sanitätswesen, Boot, Tauchen, Strömungsrettung, Funk),
- hochmoderne Technik wie Rettungsboote, Sonar oder Seiltechnik nutzen,
- rund um die Uhr ehrenamtlich einsatzbereit sind,
- dabei selbst erheblichen Gefahren ausgesetzt sind,
- und weit mehr leisten als nur „am See aufzupassen“ – etwa bei Sportveranstaltungen, in der Jugendarbeit oder in der Prävention.
- Und das alles immer vollkommen ehrenamtlich in unserer Freizeit. Ganz nach dem Motto: Unsere Freizeit für ihre Sicherheit!
Im Bereich der Wasserrettung zeigt sich immer wieder, dass selbst bei anderen Hilfsorganisationen häufig unklar ist, über welches Fachwissen und Material die DLRG tatsächlich verfügt. Während die Feuerwehr im Einsatzfall die Gesamtleitung übernimmt, liegt die eigentliche Rettung im Wasser in der Verantwortung der DLRG, da sie in diesem Bereich über die notwendige Fachexpertise und spezialisierte Ausrüstung verfügt.
Wichtig ist, dass die DLRG nicht auf ihre Rolle als „Schwimmschule“ reduziert wird, sondern als das wahrgenommen wird, was sie ist: eine hoch spezialisierte, ehrenamtlich getragene Rettungsorganisation, die an 365 Tagen im Jahr für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz ist.
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: