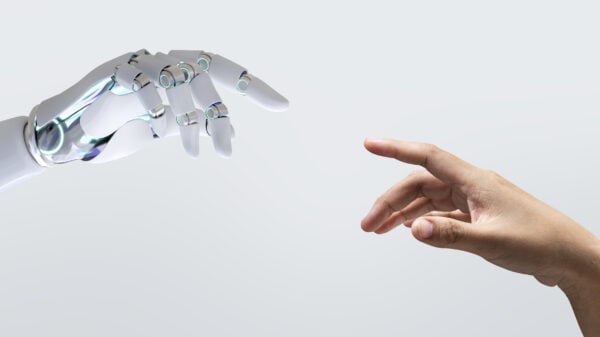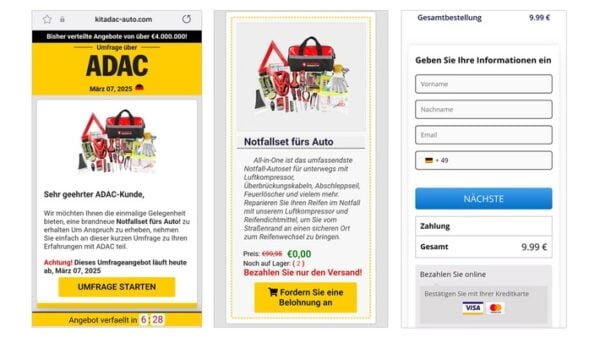Die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) engagiert sich in zahlreichen Projekten an der Erarbeitung von weiterführenden Lösungen, um Künstliche Intelligenz (KI) im Brandschutz anwendbar zu machen. Autonome Systeme, KI-gestützte Entscheidungshilfen und intelligente Sensorik könnten die Zukunft in der Gefahrenabwehr prägen. Doch der Diskurs zeigt deutlich: Das Problem ist nicht die Technik, sondern die Frage, wie der Transfer in die Praxis gemeistert werden kann.
Diese zentrale Herausforderung wurde am ersten Tag der 71. vfdb-Jahresfachtagung durch den rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten Dirk Herber (bis 2016 Polizeibeamter), Carl-Bernhard Heusinger (seit 2019 Vorsitzender im Koblenzer Stadtrat, seit 2021 im Landtag und Obmann im Ausschuss zur Flutkatastrophe) sowie Steven Wink (Mitglied in mehreren Landtagsausschüssen). Inhaltlich begleitet wurde die Runde vom Präsidenten der vfdb, Dirk Aschenbrenner.
Innovation als Notwendigkeit
Aschenbrenner eröffnete die Diskussion mit einem historischen Vergleich: „Wir brauchen Innovationen, um Fähigkeitslücken zu schließen. Seitdem es Feuerwehr und Rettungsdienst gibt, wissen wir, dass es Herausforderungen und Aufgabenstellungen gibt, in denen wir personell, technisch und organisatorisch nicht mehr allein Herr der Lage sein können.“ Als Sinnbild führte er die Entwicklung der Drehleiter an: Als Häuser höher gebaut wurden, musste eine Innovation her, damit Menschen nicht mehr in Tücher aus brennenden Häusern heraus springen mussten. Heute werden sogar Drohnen eingesetzt, damit Einsatzkräfte von der Drehleiter aus präzise erkennen können, wo gelöscht werden muss – für effizienteres Arbeiten statt wahllosen Löschens.
Es gebe aufgrund der Weiterentwicklung der Welt immer wieder neue Fähigkeitslücken, betonte Aschenbrenner und stellte die wohl zentrale Frage an die Politik: „Welche politischen Prozesse können losgetreten werden, um neue Techniken für die Feuerwehren praktisch nutzbar zu machen?“
Zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz
Dirk Herber mahnte zu einem ausgewogenen Verhältnis: „Wir sollten uns überlegen, ob wir unser Vertrauen völlig in die künstliche Intelligenz setzen oder wir unsere natürliche Intelligenz auch mal wieder etwas in den Vordergrund rücken und uns auf den menschlichen Verstand etwas mehr verlassen wollen.“ Dennoch erkannte er das Potenzial der KI zur Schließung von Fähigkeitslücken, insbesondere bei der Bevölkerungswarnung, wodurch eine breitflächigere Erreichbarkeit der Menschen möglich werde.
Konkrete Anwendungen bereits im Einsatz
Carl-Bernhard Heusinger brachte ein praktisches Beispiel aus dem Rettungsalltag ein: In Ludwigshafen helfe KI bereits bei Sprachbarrieren in Rettungsleitstellen. „Es rufen Menschen an, die nicht so gut Deutsch können, sondern eine andere Sprache sprechen. Ein konkretes Projekt erkennt die Sprache der Anrufenden direkt und übersetzt während des Anrufs die fremdsprachigen Sprechanteile ins Deutsche und umgekehrt“, sagt Heusinger. Solche Anwendungen seien durch KI relativ einfach umsetzbar, müssten aber erst implementiert werden.
Bürokratie als größtes Hindernis
Steven Wink identifizierte das Hauptproblem: „Ich glaube Geld ist in erster Linie nicht das Problem, das ist oftmals da. Es ist eher die Bürokratie: lange Genehmigungsverfahren, die vor allem dann eine Rolle spielen, wenn ein Projekt aus der Forschung heraus in die Anwendung gebracht werden soll.“ Zertifizierungen und Normen würden den Transfer teilweise unnötig verzögern.
Besonders kritisch sah Wink die Grundsatzfrage, ob Bevölkerungsschutz über, unter oder gleichberechtigt neben Datenschutz stehe. „Diese Fragen müssen von der Politik für die Menschen geklärt werden, um gewisse Technologieängste der Gesellschaft zu verringern“, fordert Wink.
Er forderte in diesem Kontext einen Mentalitätswechsel und verwies auf Länder wie Estland und Finnland, in denen das Vertrauen in KI bereits deutlich höher sei. Das deutsche Problem bestehe seiner Meinung nach vor allem darin, dass sich das Land in einer Phase befinde, „in der wir uns mehr darauf konzentrieren, wie wir KI regulieren und begrenzen, und weniger darauf, wie wir Chancen nutzen können“.
Strukturelle Herausforderungen
Herber sah dagegen das grundsätzliche Problem in der Geschwindigkeit staatlicher Prozesse:
„Ich glaube im Moment ist der Staat einfach zu träge, als dass er sich an die Realitäten anpassen könnte, die sich so schnell entwickeln. Es gibt Technologien, die sich sehr schnell weiterentwickeln, aber der Rechtsrahmen kommt nicht zügig genug hinterher.“
Heusinger benannte den deutschen Föderalismus als zusätzliche Herausforderung: „Dadurch, dass wir in Deutschland drei Ebenen haben, die für unterschiedliche Anteile am Bevölkerungsschutz zuständig sind, ist die Abstimmung wesentlich wichtiger.“ Besonders bei der technischen Implementierung stelle sich die Frage, wer welches KI-Tool implementiert. „Katastrophen halten sich nicht an regionale Grenzen. Man muss in der Lage sein, überregional einheitliche Tools zum Bevölkerungsschutz zu verwenden.“
Finanzierung und Bewusstsein
Aschenbrenner wies auf ein Bewusstseinsproblem hin: „Sicherheitsforschung ist ein Thema, das vom Bund seit über 15 Jahren stark gefördert wird mit 60 Millionen Euro pro Jahr. Vielen Landespolitikern war das gar nicht klar – dass der Bund Geld investiert, um Lösungen zu finden, damit Fähigkeitslücken geschlossen werden.“
Gleichzeitig kritisierte er die traditionelle Haltung in der Feuerwehr: „Wie funktioniert denn Feuerwehr traditionell? – ‚Das haben wir immer schon so gemacht, das hat sich bewährt‘. Innovation ist nicht gerade das, was dort ganz oben auf der Tagesordnung steht“.
Blick in die Zukunft
Für die nähere Zukunft prognostiziert Aschenbrenner folgendes Szenario:
„In zehn Jahren wird die Welt eine völlig andere sein und die Gefahrenabwehr muss Schritt halten – das muss sie nicht nur technologisch, sondern auch mit ihren Menschen und Konzepten. Da die Welt so komplex ist, braucht man auch komplexe Mechanismen, um darauf zu antworten.“
Die Länder seien „die Lücke, die geschlossen werden muss“, während der Bund bereits investiere.
Mut zur Veränderung
Herber forderte eine neue Fehlerkultur: „Wir müssen wieder mutig sein dürfen und auch den Mut haben, Fehler zu machen, sie sich einzugestehen und dann weiterzumachen. Politik muss einen Rechtsrahmen schaffen, damit sich Menschen in der Gefahrenabwehr trauen, mutig zu sein.“ Statt reiner Schreibtischforschung brauche es die Zusammenführung von Forschung und Realität durch einen weitumfassenden Rechtsrahmen.
Heusinger betonte die Bedeutung der Vernetzung: Je besser die Forschung in Deutschland bereits vernetzt sei, umso einfacher sei eine vernetzte Umsetzung in Politik und Praxis. Der Föderalismus müsse „in Bezug auf das Thema des Bürokratieabbaus effizient für die Zukunft verändert werden.“
Kritik aus der Praxis
Aus dem Auditorium kam deutliche Kritik an „leeren Worten“. Es werde zwar Veränderungsbedarf erkannt, aber letztendlich nichts getan. Die Praktiker in der Gefahrenabwehr sollten neue Dinge ohne lange vorherige Beschlüsse ausprobieren dürfen. Zudem wurde Vernetzung gefordert, da bei einem flächendeckenden Einsatz von KI ohnehin Standardisierung notwendig werde.
Fazit: Gemeinsam über Grenzen hinweg
Aschenbrenner fasste die Kernbotschaft am Ende der Diskussion zusammen: „Es ist unstrittig: Die Welt wird sich verändern und wir müssen Schritt halten. Der wesentliche Faktor zum Schritt-Halten ist nicht die Technologie, sie ist nur ein Instrument, sondern der wesentliche Faktor ist, das gemeinsam zu tun.“
Die Podiumsdiskussion hinterlässt zudem eine deutliche Kritik am Föderalismus: „In den Strukturen des Föderalismus werden wir unsere Probleme nicht lösen. Wir rennen den Aufgaben immer ein Stück weit hinterher, weil wir 16-mal im Land das gleiche an unterschiedlichen Stellen tun, anstatt einmal unsere Kräfte zu bündeln“, verdeutlicht Aschenbrenner. Die Lösung sei klar:
„Unsere Fähigkeiten werden wir nur optimal einsetzen können, wenn wir erkennen, dass wir es gemeinsam über Grenzen hinweg tun können. Die Technologien und die Aufgaben sind da, aber das Zusammen fehlt.“
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: