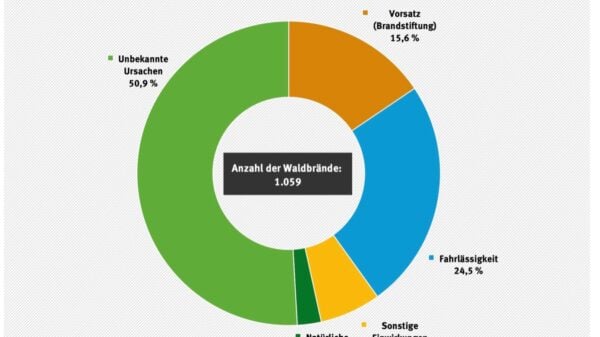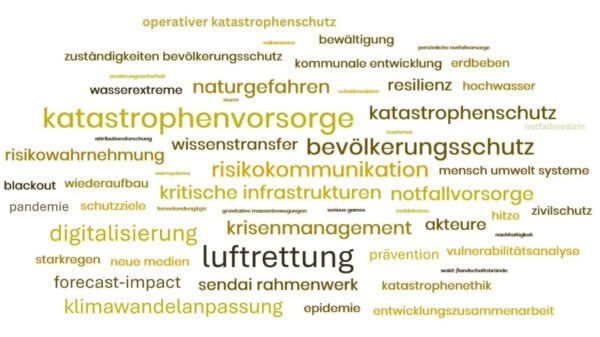Schon seit einige Jahren liegen die Bedarfe und Forderungen für den Bevölkerungsschutz auf dem Tisch. Über alle föderalen Ebenen war und ist aber auch die Notwendigkeit gegeben, strikte Ausgabendisziplin zu wahren. Daher bestand und besteht durchaus ein Zielkonflikt im Bevölkerungsschutz. Nicht alles, was wünschenswert ist, kann auch bezahlt werden. Gleichzeitig ist der Bevölkerungsschutz ein zentrales Element des Schutzversprechens des Staates gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern. Neben anderen hatte ich in der letzten Woche Gelegenheit, einige Aspekte dieses Zielkonflikts auszuleuchten.
Da natürlich in einem Artikel, in dem mehrere Personen zu Wort kommen, nicht alle Facetten meiner Ausführungen umfassend Berücksichtigung finden können, möchte ich diese Aspekte hier nochmals vorbringen, weil sie natürlich doch zum ganzen Bild der Lage gehören:
Rolle der Bürgerinnen und Bürger
Dass die Risikowahrnehmung in der Bevölkerung, sagen wir mal bisweilen „mau“ ist, ist gar nicht so überraschend. Wenn viele Jahre der öffentlich vermittelte Eindruck der Politik war. „Ihr braucht Euch nicht zu kümmern! Wir haben das im Griff!“, dann verlassen sich die Bürger auf dieses Schutzversprechen des Staates. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es heute keine hundertprozentige Sicherheit mehr gibt. Vielleicht gab es sie auch nie, wir haben es vielleicht nur nicht wirklich sehen wollen. Aktuell ist der Satz prägend „Wir leben noch nicht im Krieg, aber auch schon lange nicht mehr im Frieden!“ Und dieser Frieden ist eine wirkliche gesamtstaatliche, aber besonders gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und da ist neben staatlichen Milliarden und Strukturen eben auch jeder und jede Einzelne gefragt und muss einen individuellen Beitrag leisten. Wie der aussieht, darüber muss man in der Folge sprechen. Der Staat lebt halt, ganz nach Ernst-Wolfgang Böckenförde, von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann.
Das robuste zivil-militärische Netz
Ich wurde gefragt, wie denn das von mir bereits an anderer Stelle genannte „robuste zivil-militärische Netz“ konkret aussehen müsste. Aus meiner Sicht müsste dieses Netz stabile Grundlagen (Ankerpunkte) haben. Da steht als erstes eine resiliente Bevölkerung. Menschen die unempfänglich für gegnerische Narrative sind, die von ihrem Staat und ihrem Gemeinwesen überzeugt sind, bieten schon bei der gegnerischen „Lagefeststellung“ eine hohe Hürde, wenn man den möglichen Erfolg etwa eines hybriden Angriffs bewerten will. Zweitens braucht es funktionierende Staats- und Regierungsfunktionen. Entscheidungen müssen legitim getroffen und umgesetzt werden können. Auch Angriffe gegen Regierungsnetze können abgewehrt werden, oder es gibt hinreichende Redundanzen. Der Staat muss sich auf ein Mindestmaß an Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, etwa in den ersten 48 Stunden einer Lage, verlassen können. Danach kommen die strukturierten Hilfeleistungspotenziale zum Einsatz. Und ja, wir brauchen für Schlüsselgüter und -produkte, etwa Blut, Medikamente, Masken, Feldbetten, Zelte, etc. einen zivil-militärischen Plan für die Logistik und Vorhaltung. Logistikketten sind heute die Achillesferse einer jeden Gesellschaft.
Das große Manko im Bevölkerungsschutz
Ähnlich wie der Zivilschutz wurde auch der Katastrophenschutz zu oft nach Kassenlage und nach Ereignis-Peak gemacht. Der Bevölkerungsschutz wird also nicht aktiv gestaltet, sondern reaktiv vollzogen. Wenn in den letzten Jahren z.B. wieder einmal eine Hochwasserlage akut war, wurden vielfach Maßnahmen zum Hochwasserschutz priorisiert. Wenn die Aufmerksamkeitsspanne (nicht nur der Bevölkerung) dann wieder nachließ, wurden häufig dann auch weitere Maßnahmen z.B. zur Deichertüchtigung wieder zeitlich gestreckt und nachgeordnet priorisiert. Als die Corona-Pandemie auf ihrem Höhepunkt war, wurde etwa der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschmiedet, jetzt müssen die Beteiligten kämpfen, um eine Fortsetzung des Pakts zu erreichen. Weder beim Zivil- noch beim Katastrophenschutz ist ein echter gemeinsamer Plan von Bund, Ländern, Gemeinden und Hilfsorganisationen zu erkennen. Und das, wo wir eigentlich mit der Zeitenwende und dem Fokus auf das Jahr 2029 echt viel Druck auf dem System haben.
Resümee
Die Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist aller Ehren wert. Es wird einige Defizite, die sich in den letzten Jahren aufgebaut haben, schrittweise abbauen helfen. Aber sie bringen natürlich noch keine gemeinsame Idee, noch keine gemeinsame Bedrohungs- und Risikoanalyse, geschweige denn eine gemeinsame Bewertung. Der Nationale Sicherheitsrat wäre der richtige Ort dafür. Und dann durchdeklinieren über alle föderalen Ebenen und die wichtigen anderen Player auf dem Feld des Bevölkerungsschutzes, wie etwa die anerkannten Hilfsorganisationen nach dem DRKG und dem ZSKG.
Den gesamten Artikel können Sie hier lesen:
Katastrophenschutz: Werden 10 Milliarden Euro im Bürokratie-Chaos versenkt? | Euronews
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: