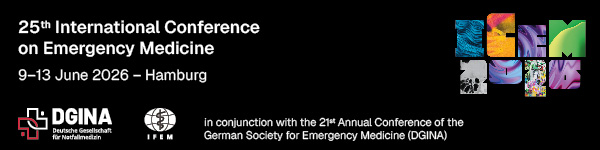Die Herausforderungen für den Katastrophenschutz in Deutschland und in Rheinland-Pfalz haben in den letzten Jahren massiv an Komplexität zugenommen. Naturkatastrophen, wie die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021, oder menschengemachte Krisen, wie die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, haben uns gezeigt, wie fragil unsere Sicherheitsarchitektur sein kann. Doch nicht nur akute Gefahren stellen uns vor Herausforderungen. Der Klimawandel führt zu einem deutlichen Anstieg der Anzahl extremer Wetterereignisse, wie langanhaltende Dürreperioden, Starkregen oder verheerende Stürme. Hinzu kommen neue Bedrohungsszenarien wie großflächige Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, die potenziell ganze Regionen lahmlegen können.
Rheinland-Pfalz hat entschlossen auf diese Entwicklungen reagiert. Die Landesregierung hat im Spätsommer 2022 eine umfassende Neuausrichtung des Katastrophenschutzes beschlossen, die auf einer engen Verzahnung von Landes- und Kommunalebene basiert. Ziel ist es, widerstandsfähige Strukturen zu schaffen, schnellere Reaktionszeiten zu ermöglichen und eine effektive Vernetzung aller relevanten Akteure sicherzustellen.
Ein zentraler Meilenstein ist dabei die Gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK), das zum 1. Januar 2025 offiziell seinen Betrieb aufgenommen hat. Dieses Amt bildet die zentrale Steuerungs- und Koordinationsstelle, um den Brand- und Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz zukunftsfähig zu machen.
Lehren aus der Vergangenheit: Die Flutkatastrophe im Ahrtal
Die Flutkatastrophe im Juli 2021 hat auf dramatische Weise verdeutlicht, wie wichtig schnelle, koordinierte Hilfe im Katastrophenfall ist. Binnen weniger Stunden verwandelten sich Flüsse wie die Ahr in reißende Ströme, die ganze Ortschaften zerstörten, Infrastruktur vernichteten und 134 Menschenleben forderten. Aus diesen Erfahrungen wurden klare Konsequenzen gezogen:
Rheinland-Pfalz setzt verstärkt auf ein verbessertes Warnsystem, um die Bevölkerung schneller und effektiver auf Gefährdungen aufmerksam zu machen. Hierbei setzen wir auf einen landesweiten Warnmittel-Mix. Das heißt, das neben klassischen Warn-Apps, Cell-Broadcast und Warnungen über die Rundfunkanstalten auch Sirenen zum Einsatz kommen, die zur Alarmierung der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Zudem wird die Schulung der Bevölkerung im Umgang mit Warnmeldungen intensiviert, damit diese im Ernstfall schnell und richtig reagieren kann.
Das neue Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz
Der Bevölkerungsschutz erfordert aber mehr als nur technische Lösungen: Prävention, Schulung und eine enge Zusammenarbeit aller Akteure sind essenziell. Die Kommunikation zwischen Einsatzkräften, Landesregierung und weiteren Akteuren wurde gestärkt, um einen schnellen und verlässlichen Informationsaustausch zu gewährleisten.
Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) vereint daher unter einem Dach eine Vielzahl von wichtigen Funktionen, die entscheidend zur Effizienz und Reaktionsfähigkeit des Katastrophenschutzes beitragen. Dafür wurden die Aufgaben des für den Katastrophenschutz zuständigen Referates der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) und der Feuerwehr- und Katastrophenschutzakademie Rheinland-Pfalz (LFKA) gebündelt und um zusätzliche Aufgaben ergänzt. Die Leistungsfähigkeit in den Bereichen resiliente Notfallplanung, Krisen- und Lagemanagement, Infrastruktur und Technik im Brand- und Katastrophenschutz sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung im Brand- und Katastrophenschutz wird durch das neue Landesamt ausgeweitet und mit einem Zielhorizont im Jahr 2030 stufenweise ausgebaut.
Das Lagezentrum Bevölkerungsschutz ist das operative Zentrum des neuen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz und spielt eine zentrale Rolle in der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr. Im Falle eines Ereignisses oder einer landesweit relevanten Lage im Bereich der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr liefert es schnellstmöglich ein Lagebild, das als Grundlage für Entscheidungen und Handlungen dient. Das Lagezentrum verfolgt kontinuierlich und aktiv die landesweite Situation in diesem Bereich und fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen und Hilfeersuchen der kommunalen Aufgabenträger, anderer Landesbehörden, Länder und des Bundes (GMLZ). Besondere Bedeutung kommt hier der direkten Kommunikation und der Zusammenarbeit mit den Integrierten Leitstellen des Landes zu.
Zur Stärkung der Handlungsfähigkeit im Ereignisfall werden im Lagezentrum alle Informationen aus den einzelnen Leitstellenbereichen zusammengeführt, um so unter anderem eine gezielte landesweite Koordination von Einsatzmitteln zu ermöglichen. Zudem erfolgt hier die ereignisbezogene Kommunikation mit anderen relevanten Einrichtungen oder Landesbehörden. Das Lagezentrum wurde in bereits bestehenden Räumen bei der LFKA eingerichtet und umfasst neben dem Lagezentrum selbst einen Lageraum, ein operatives Büro für die Lagedienstführung, einen Sozialraum, zwei Büroräume sowie Technik- und Serverräume. Die gesamte Nutzfläche des Bereichs beträgt etwa 201 m². Der „Spatenstich“ für die Umbaumaßnahmen fand am 23. August 2023 statt.
Darüber hinaus ist das Lagezentrum an die zentrale Auskunfts- und Vermittlungstechnik (zAVt) angebunden, die die zentrale Kommunikationsinfrastruktur aller polizeilichen und nicht-polizeilichen Leitstellen in Rheinland-Pfalz darstellt. Über diese Infrastruktur werden sämtliche Kommunikationskanäle wie Telefon, Digitalfunk und ePost abgewickelt.
Das Lagezentrum setzt mit seiner Ausstattung und seinem Leistungsspektrum einen neuen bundesweiten Standard. Es nahm seinen Betrieb im Dezember 2024 auf. Mitte des Jahres 2025 wird es als erstes seiner Art bundesweit rund um die Uhr besetzt sein. Es überwacht laufend aktuelle Entwicklungen und gewährleistet, dass alle erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr gezielt eingeleitet werden. Als Herzstück der Krisenbewältigung koordiniert es alle relevanten Akteure und sorgt für eine effiziente Steuerung in Ausnahmesituationen.
Ein weiterer zentraler Aspekt der Arbeit des LfBK ist die enge Zusammenarbeit mit Universitäten und Forschungseinrichtungen. Das Amt fördert die Wissenschaft und Ausbildung im Bereich des Katastrophenschutzes und ist bestrebt, innovative Lösungen für zukünftige Herausforderungen zu entwickeln. Durch diese Kooperationen wird sichergestellt, dass Rheinland-Pfalz stets auf dem neuesten Stand der Forschung bleibt und neue Erkenntnisse in die praktische Arbeit integriert werden.
Die Neuausrichtung des Katastrophenschutzes: Ein umfassendes Reformprojekt
Die Neuausrichtung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz basiert auf einem klaren Konzept, das drei zentrale Bereiche umfasst:
1. Die Stärkung der Landesstrukturen:
Mit der Gründung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) wurde ein bedeutender Schritt vollzogen, der einen Paradigmenwechsel markiert. Anstelle einer dezentralen Organisation gibt es nun eine zentrale Kompetenzstelle des Landes im Bereich Brand- und Katastrophenschutz. Diese zentrale Kompetenzstelle agiert nicht nur als strategische Instanz, sondern auch als Dienstleister für die Kommunen und Landkreise, indem sie ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.
Die Neuausrichtung des Katastrophenschutzes erfordert erhebliche finanzielle Mittel. Daher haben wir die Mittel im Brand- und Katastrophenschutz von rund 95 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2023/2024 auf nunmehr rund 142 Millionen Euro im Doppelhaushalt 2025/2026 erhöht. Das ist eine Steigerung auf das 1,5-fache.
Allein für den Ausbau des LfBK sind 14 Millionen Euro vorgesehen. Perspektivisch soll das Amt bis 2030 auf 300 Stellen anwachsen, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
2. Die Stärkung der kommunalen Strukturen:
Die Zusammenarbeit zwischen der Landes- und der Kommunalebene spielt eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Bewältigung von Katastrophen. Um diese Zusammenarbeit zu intensivieren, werden beim LfBK drei Regionalstellen eingerichtet, die den direkten Austausch mit den Kommunen fördern. Ziel dieser Regionalstellen ist es, lokale Akteure anzusprechen und zu vernetzen und die spezifischen Herausforderungen, die in verschiedenen Regionen bestehen, besser zu berücksichtigen. So wird sichergestellt, dass die Gefahrenabwehr sowohl auf Landes- als auch auf kommunaler Ebene gleichermaßen effektiv und anpassungsfähig bleibt.
Die Landesregierung unterstützt die Besetzung von Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren mit hauptamtlichen Feuerwehrbeamten. Dies trägt den gestiegenen Anforderungen Rechnung und fördert die effektive Gefahrenabwehr vor Ort. Zur weiteren Stärkung der kommunalen Strukturen wird künftig ein Zwei-Stabs-Modell unter der Leitung des kommunalen Hauptverwaltungsbeamten (Landrat oder Oberbürgermeister) vorgeschrieben, um eine klare und effektive Einsatzleitung sicherzustellen. Neben der Technischen Einsatzleitung, die für die Bewältigung der Lage zuständig ist, wird es im Einsatzfall auch einen Verwaltungsstab geben, der sich mit rechtlichen und organisatorischen Fragestellungen befasst. Zudem muss eine umfassende Führungsunterstützung für die verantwortliche Kommune sichergestellt werden.
3. Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen:
Die Überarbeitung des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes bildet die Grundlage für eine moderne und zukunftssichere Gefahrenabwehr. Durch die Schaffung klarer Zuständigkeiten wird die Zusammenarbeit der verschiedenen Ebenen optimiert. Ergänzend sorgen regelmäßig aufzustellende Bedarfs- und Entwicklungspläne nach Vorgaben des Landes auf kommunaler Ebene dafür, weitere Qualitätsstandards im Bereich Brand- und Katastrophenschutz zu etablieren. Dies gewährleistet, dass Rheinland-Pfalz nicht nur auf aktuelle Herausforderungen gut vorbereitet ist, sondern auch flexibel auf künftige Gefahrenlagen reagieren kann. Die Zuständigkeit für die Einsatzleitung im Katastrophenfall bleibt aber bei den Kommunen. Dennoch hat das neue Landesamt bei Bedarf die Möglichkeit, die Einsatzleitung zu übernehmen und den Behörden vor Ort Weisungen zu erteilen.
Blick in die Zukunft: Katastrophenschutz im digitalen Zeitalter
Die Digitalisierung bietet enorme Chancen für den Katastrophenschutz. Künstliche Intelligenz kann beispielsweise dabei helfen, Naturkatastrophen frühzeitig zu erkennen und präzise Warnungen auszugeben. Drohnen können bei der Lageerkundung in unzugänglichem Gelände eingesetzt werden, während digitale Kommunikationsplattformen eine schnellere Abstimmung ermöglichen.
Das LfBK hat sich zum Ziel gesetzt, technologische Innovationen aktiv voranzutreiben. Gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft werden neue Ansätze erprobt, um den Bevölkerungsschutz noch effektiver zu gestalten.
Das Landesamt als Fundament für einen modernen Katastrophenschutz
Die Neuausrichtung des Katastrophenschutzes in Rheinland-Pfalz mit der Schaffung des Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) geht weit über organisatorische Veränderungen hinaus. Es markiert einen fundamentalen Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen, resilienten Sicherheitsarchitektur. Das LfBK ist der Dreh- und Angelpunkt, an dem alle Fäden des Katastrophenschutzes zusammenlaufen. Es steht für eine neue Ära des Zusammenarbeitens, Planens und Reagierens, die sich flexibel und schnell an neue Herausforderungen anpasst. Durch seine zentrale Rolle wird es zur stabilen Grundlage für die Sicherheit der Menschen in Rheinland-Pfalz, nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch in der präventiven Ausrichtung.
Die tiefgreifende Bedeutung des LfBK liegt nicht nur in seiner funktionalen Ausrichtung, sondern auch in seiner Fähigkeit, eine langfristige Vision für den Katastrophenschutz zu verwirklichen. Als zentraler Akteur im System ermöglicht es eine koordinierte und effiziente Bewältigung von Gefährdungslagen und legt dabei besonderes Augenmerk auf schnelle Reaktionszeiten und nachhaltige Lösungen. In einem sich stetig verändernden Umfeld wird das LfBK als Katalysator für Innovationen und Anpassungen fungieren, wodurch es Rheinland-Pfalz hilft, nicht nur auf die heutigen Herausforderungen vorbereitet zu sein, sondern auch auf die, die noch kommen.
Mit der Einrichtung des LfBK und dem Lagezentrum Bevölkerungsschutz beweist Rheinland-Pfalz Weitsicht und Entschlossenheit, den Bevölkerungsschutz auf ein neues Niveau zu heben. Es zeigt sich nicht nur als Reaktion auf die Herausforderungen der Gegenwart, sondern als visionäre Antwort auf die Bedürfnisse einer sicheren und gut vernetzten Zukunft. Die enge Zusammenarbeit zwischen Land, Kommunen und allen relevanten Akteuren bildet das Rückgrat dieser zukunftsweisenden Struktur und garantiert, dass Rheinland-Pfalz weiterhin als ein Ort sicherer und verlässlicher Gemeinschaft auch in den kommenden Jahren bestehen bleibt.
Autor: Michael Ebling (Innenminister Rheinland-Pfalz)
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: