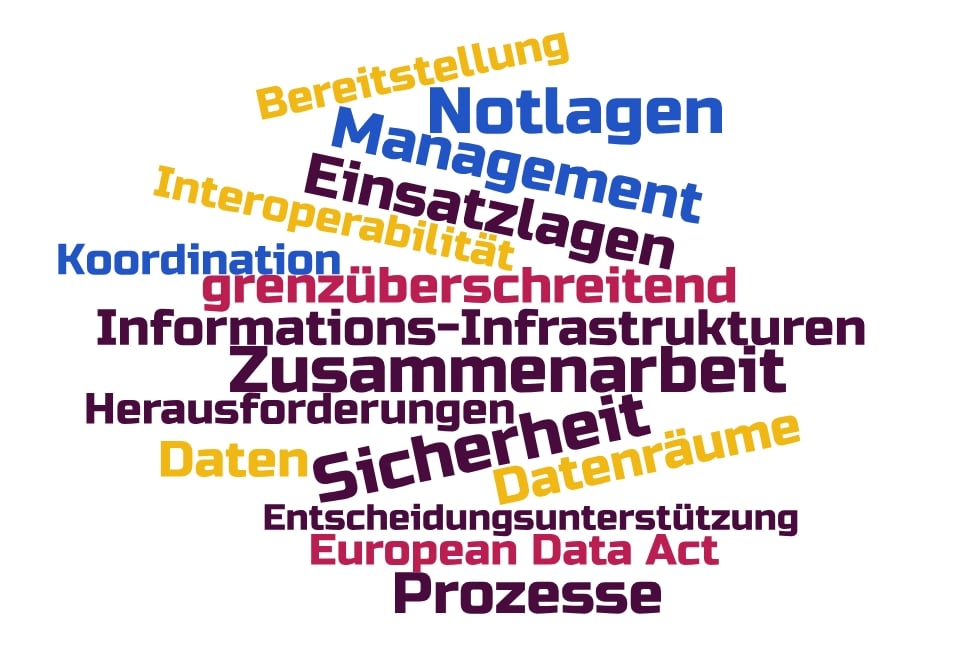Die Europäische Union hat verbindliche Vorgaben gemacht, durch die in Fällen von öffentlichen Notlagen oder in anderen Ausnahmesituationen die Bereitstellung von Daten für öffentliche Stellen, die Kommission, die Europäische Zentralbank oder Einrichtungen der Union geregelt werden. Die Aufgabenstellungen betreffen nunmehr u.a. Datenzugang und -nutzung durch öffentliche Stellen, Technische Infrastruktur, Datenbereitstellung in Notlagen sowie Interoperabilität.
1. Der Europäische Data Act
Die Europäische Union hat in ihrem Data Act vom 13. Dezember 2023 Vorgaben gemacht, die in Fällen von außergewöhnlicher Notwendigkeit (engl.: Situations of Exceptional Need) die Bereitstellung von Daten für öffentliche Stellen, die Kommission, die Europäische Zentralbank oder Einrichtungen der Union regeln. Fälle von außergewöhnlicher Notwendigkeit können entstehen bei öffentlichen Notlagen oder anderen Ausnahmesituationen, Notlagen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Notlagen aufgrund von Naturkatastrophen, einschließlich solcher, die durch den Klimawandel und die Umweltzerstörung noch verschärft werden, sowie von Menschen verursachten schweren Katastrophen wie großen Cybersicherheitsvorfällen.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Sie trat am 11. Januar 2024 in Kraft und wird nach einer grundsätzlichen Übergangsfrist von 20 Monaten ab dem 12. September 2025 EU-weit direkt anwendbares Recht werden.
Derzeit liegt ein Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/2854 (Data Act-Durchführungsgesetz – DA-DG) vor, zu dem auch Stellungnahmen veröffentlicht wurden. Der Deutsche Städtetag äußert sich dazu auch in seinen Abschnitten „Datenzugang und -nutzung durch kommunale Einrichtungen“, „Technische Infrastruktur“, „Datenbereitstellung in Notlagen“ sowie „Interoperabilität und Teilnahme an „Data Spaces““.
Der Begriff „Situations of Exceptional Need” ist sehr umfassend und ist in der zivil-militärischen Zusammenarbeit auch anwendbar bei der operationellen Planung und Umsetzung anderer verteidigungsvorbereitender Rechtsvorschriften.
2. Interoperabilität / Informations-Infrastrukturen / Common European Data Spaces
Interoperabilität beim Informationsaustausch und bei Anwendung standardisierter Prozesse (SOPs – Standard Operational Procedures) ist Grundlage bei organisations- und grenzüberschreitenden Kooperationen. Speziell im Falle von sog. „just-in-time“ Erfordernissen für die Bereitstellung und Weiterverarbeitung von komplexen Informationen (auch „Big Data“), situativen Analysen, Entscheidungsunterstützung und Aktion sind je nach der regionalen Wirkungsweite ausgelegte und gemeinsam mit allen Beteiligten standardisierte nationale, europäische und globale Informations-Infrastrukturen unabdingbar.
Geoinformationsinfrastrukturen werden auch in den Bereichen von Schutz und Sicherheit sowie in der zivil-militärischen Zusammenarbeit bereits mit großem Erfolg eingesetzt. Für rechtskonforme Entwicklungen und Anwendungen bestehen seit Jahren gesetzliche Grundlagen auf den Ebenen des Bundes und der Länder.
Entsprechende methodische und technische Entwicklungen werden dringend benötigt für Fachdaten in allen Bereichen von Schutz und Sicherheit, bei der zivil-militärischen Zusammenarbeit und in den oben genannten „Fällen von außergewöhnlicher Notwendigkeit“ resp. „Situations of Exceptional Need“. Die Komplexität der involvierten Organisationen und Institutionen erfordert in der Praxis eine massive Interoperabilität zur Realisierung aller entscheidungs- und handlungskritischen hochdynamischen Prozesse. Diese auch in anderen Fachgebieten erfolgreich eingesetzten Methoden und Techniken der angewandten Informatik ermöglichen just-in-time Informationsgenerierung, Übermittlung, situative Analyse, Entscheidungsunterstützung, Aktion und Zielerreichungskontrolle unter konkret vorgegebenen zeitlichen Randbedingungen.
Die Europäische Union hat mit ihrem „Interoperable Europe Act“ bereits für alle Mitgliedsstaaten den verbindlichen Rechtsrahmen und koordinierte Vorgehensweisen für Informations-Infrastrukturen in allen Bereichen vorgegeben. Begleitend haben sich bereits gemeinsame Datenräume (Common European Data Spaces) etabliert.
„The Common European Data Spaces … will allow data from across the EU to be made available and exchanged in a trustworthy and secure manner. EU Businesses, public administrations, and individuals will control the data they generate. At the same time, these data holders will benefit from a safe and reliable framework to share their data for innovation purposes”
“The Commission has put forward a framework to develop and implement multi-country projects (MCPs). MCPs are large-scale projects that allow for Member States’ intervention in strategic areas to contribute to the digital transformation of the EU”
Die massiven Fortschritte bei der Erarbeitung und dem Betrieb von fachspezifischen Informations-Infrastrukturen – teilweise über viele Jahre hinweg – sowie die intensiven Förderungen und Betreuung bei der Generierung der „European Common Data Spaces“ lassen diese Konzepte als Stand der Technik erscheinen.
Es wird daher angeregt, einen zusätzlichen Europäischen Datenraum für Schutz und Sicherheit „Common European Information Space for Safety and Security“ einzurichten und zu betreiben.
Das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr (jetzt Territoriales Führungskommando) hatte bereits 2021 für die zivil-militärische Zusammenarbeit einen „Territorial Hub“ in Arbeit, der als Vorbereitung für die Krisen und Aufgaben von morgen anzusehen ist. Das CTF Baltic (auch zitiert im Arbeitspapier Sicherheitspolitik, Nr. 4/2025) hat seit Oktober 2024 für den gesamten Ostseeraum in vergleichbarer Weise die Aufgabe, militärische und zivile Daten zusammenzuführen.
3. Personalmanagement
Nicht zuletzt hat die parlamentarische Aufarbeitung der Ahrtal-Katastrophe auch auf die besonderen Herausforderungen im Personalmanagement bei langfristigen Einsatzlagen aufmerksam gemacht. Alle physischen Prozesse und alle Informationsprozesse bedürfen insbesondere bei hochvernetzten, risiko- und gefahrenbehafteten Tätigkeiten unter hohem Zeitdruck einer besonderen Koordination. Dabei muss die Zielerreichung dauerhaft kritisch betrachtet werden, damit bestmögliche Erfolge im Sinne aller Betroffenen sichergestellt werden können.
Auch solche Daten sind über entsprechend ausgelegte Informations-Infrastrukturen für die Sicherstellung adäquater Erfolgsmöglichkeiten aufzubereiten. Insbesondere bei grenzüberschreitenden Großübungen sowie bei der Planung operativer Vorgehensweise im internationalen Rahmen sind strukturierte Ontologien für Rollen, Fähigkeiten, Verfügbarkeiten, Vertretungen etc. sowie mit diesen Strukturelementen einhergehende (virtuelle und physische) Objektbildungen, Attribute und Prozesse auf der Basis vorab gemeinsam erarbeiteter internationaler Standards von besonderer Bedeutung.
4. Perspektive
Die Herausforderungen für die Anwendung und Nutzung des Stands der Technik bei Interoperabilität und Informations-Infrastrukturen in allen Bereichen von Schutz und Sicherheit (engl. Safety and Security) sind erheblich. Die föderale Struktur der Zuständigkeiten wird noch oft als essentiell hinderlich angesehen, jedoch hat die praktische Erfahrung in anderen Fachgebieten gezeigt, dass rechtliche und operative Zuständigkeiten insoweit nicht tangiert werden. Interoperabilität und Informations-Infrastrukturen entstehen durch Kooperation der Beteiligten mit dem Ziel, die erforderliche Koordination in den zentralen informatorisch gemeinsamen Belangen methodisch und technisch zu ermöglichen und in resilienter Weise dauerhaft sicherzustellen.
Autor: Horst Kremers (https://RIMMA.org)
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: