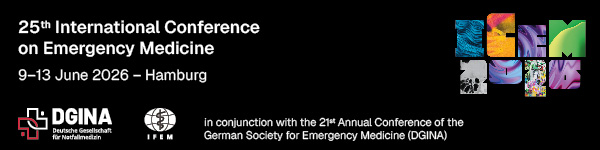Ein Massenanfall von Verletzten (MANV) stellt an präklinische und klinische Strukturen besondere Anforderungen. Zur erfolgreichen Bewältigung müssen in beiden Bereichen bei Ereigniseintritt Abläufe umgestellt und räumliche, materielle und personelle Ressourcen erweitert bzw. optimal ausgeschöpft werden. Die fachgerechte Verteilung der Patient(inn)en auf die Krankenhäuser sollte, um eine optimale Patientenversorgung zu gewährleisten und Überforderung zu vermeiden, auf der Basis der verfügbaren Aufnahme- und Behandlungskapazitäten, also der Leistungsfähigkeit, der Kliniken erfolgen. Dafür muss die Leistungsfähigkeit bekannt und im Ereignisfall aktuell abrufbar sein. Diese bemisst sich an den im Krankenhaus zur Verfügung stehenden Ressourcen. Ihre Dynamik in Abhängigkeit von Faktoren wie Tageszeit, Wochentag, aktueller Auslastung aber auch Ereignismerkmalen können ebenso wie Geräteausfälle, die Urlaubszeit oder die Standortänderung mobiler Beatmungsgeräte zu relevanten Änderungen führen. Zwar wird in vielen Veröffentlichungen die Kapazitätsbemessung gefordert, jedoch werden darin genaue Herangehensweise nicht geschildert.
Einzelne Vorschläge zur Bemessung der Kapazitäten wurden national und international vorgelegt. Sie unterscheiden sich einerseits hinsichtlich der Methoden: Auszählung vorhandener Kräfte und Mittel, Planspiele, Übungen, Modell-Simulationen. Darüber hinaus erfolgt eine Unterscheidung hinsichtlich der erfassten Ressourcen (z. B. Behandlungszeit pro Patienten, Patientendurchsatz, Betten, spezialisierte Raumkapazitäten, Managementkompetenzen, verfügbares Personal). In unterschiedlichem Maße beziehen sie auch Planungen zur kliniksübergreifenden Dokumentation der verfügbaren Ressourcen ein.
Bei genauerer Analyse wird sichtbar, dass die vorliegenden Verfahren nur jeweils ausgewählte der zur Verfügung stehenden bzw. möglichen Ressourcen und in sehr unterschiedlichem Maße die Dynamik von Ressourcen im Zeitverlauf berücksichtigen. Gegenwärtig ist in bundesdeutschen Kliniken kein klinikübergreifendes, gemeinsames System der Ressourcenbemessung vereinbart. Zudem bestimmen jeweils klinikspezifische Merkmale die Hervorhebung der Bedeutsamkeit von spezifischen Ressourcen.
Die im Folgenden berichtete Untersuchung geht davon aus, dass systematische, vollständige und klinikübergreifende Methoden zur Bemessung der dynamischen Versorgungskapazitäten erforderlich erscheinen, jedoch fehlen.
Es werden zunächst Ergebnisse einer explorativen, qualitativen Befragung von Praktiker(inne)n der medizinischen Versorgung, des medizinischen Bevölkerungsschutzes und des Desaster Managements vorgestellt und diskutiert, die das Ziel hatte, umfassend Kriterien zu bestimmen, mit denen nach einheitlichen klinikübergreifenden Kriterien innerklinische Versorgungskapazitäten dynamisch erfasst und transparent kommuniziert werden könn(t)en. In einem zweiten Schritt werden jene Ressourcen zusammenfassend aufgeführt, denen in der Fachliteratur sowie in den Interviews ein besonderer Stellenwert als Engpassressourcen beigemessen wird.
Methodik
Mögliche Kriterien der Leistungsfähigkeitsbemessung wurden zunächst auf der Basis einer systematischen Literaturrecherche in den Fachdatenbanken LIVIVO, PubMed, ScienceDirect, Scopus und Springer Link ermittelt und kategorisiert. Diese Ressourcenkategorisierung bildete die inhaltliche Struktur des Interviewleitfadens für halbstandardisierte qualitative Experteninterviews nach
- Organisation (Organisationseinheiten, Verfahrensabläufe, Einsatz- und Kommunikationsstrukturen)
- Raum (räumliche und bauliche Gegebenheiten)
- Material (Materialien, Ausstattungen und Gerätschaften)
- Personal (alle potenziell in die klinische MANV-Versorgung eingebundenen Kräfte, personelle Aspekte)
- Zeit (alle zeitlichen, die klinische MANV-Versorgung betreffenden Aspekte)
Bei der Auswahl der zehn Interviewpartner(innen) (sieben Fachärzt(inn)e(n) (Ärztliche(r) Leiter(in) Rettungsdienst, Katastrophenschutzbeauftragte(r), Klinische(r) Direktor(in), Leitende(r) Ober-/Notarzt(-ärztin), Leiter(in) Notaufnahme) aus verschiedenen Versorgungsstufen sowie drei Expert(inn)en aus den Bereichen Pflege, Notfallpsychologie und Risiko- und Katastrophenmanagement) wurde auf ein breites Erfahrungsspektrum mit dem MANV-Geschehen Wert gelegt.
Die Literaturrecherche und Interviews beschränkten sich auf häufige, „klassische“ MANV-Situationen (sog. Unfall-MANV). MANV-Situationen aufgrund von Amoklagen, Terroranschlägen, großflächigen Naturkatastrophen, CBRN-Lagen, KRITIS-Ereignissen, aber auch Schulereignissen wurden aufgrund anderer Verletzungsmuster, medizinischer sowie psychosozialer Dynamiken und zeitlicher Ausdehnung zunächst ausgeschlossen. Die persönlich im Zeitraum von Juli bis September 2020 geführten Interviews wurden aufgezeichnet, vollständig transkribiert und qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet.
Ausgewählte Ergebnisse
MANV-Ressourcen: Die Aussagen der Expert(inn)en zu erforderlichen Ressourcen beziehen sich auf unterschiedliche Organisationseinheiten, in denen Patient(inn)en mit unterschiedlichen Schweregraden der Verletzung behandelt werden (differenziert nach den 2002 konsentierten Sichtungskategorien) oder die zu deren Diagnostik (Radiologie) und (Weiter-)Behandlung (Versorgung von OP-pflichtigen Patient(inn)en) beitragen.
Ergänzend wurde hier auch die bislang nicht konsentierte, jedoch in einzelnen Interviews genannte Organisationseinheit „Rot-Plus“ aufgenommen, in der die Versorgung der kritischsten bzw. schwerst verletzten oder geschädigten Patient(inn)en mit akuter vitaler Bedrohung erfolgt. Ebenso wurde auch – der zunehmenden Bedeutung in der Praxis folgend – gesondert die organisatorische Einheit der psychosozialen Versorgung aufgenommen.
Für den MANV wurden weitere wichtige in der Ressourcenplanung zu berücksichtigende Organisationsbereiche angesprochen, wie die Intensivstation, die Reinigung, der Bereich der Blutprodukte, die Sterilisation, der innerklinischer Transportdienst und das Labor, die in der Tabelle 1 nicht aufgeführt wurden. Diese Informationen können der zugrundliegenden Gesamtdarstellung der Studie entnommen werden.
Die erforderlichen Ressourcen in den jeweiligen ausgewählten Organisationseinheiten sind in Tabelle 1 aufgeführt.
Zur Verbesserung der Abläufe, insbesondere des Monitorings und der Kommunikation werden übergreifend über alle Handlungsbereiche Checklisten, Mittel zur Personalkennzeichnung, Kommunikation und Dokumentation als Ressourcen hervorgehoben.
Ebenso wird die Sicherstellung der Verpflegung sowohl für das Personal des Krankenhauses als auch für Patient(inn)en (und Angehörigen) (v. a. im grünen Bereich und dem Bereich der psychosozialen Versorgung) als basale Ressource genannt.
Einerseits wurden die Beschaffenheit und Eignung von Räumen für die Behandlung unterschiedlicher Patientengruppen nach Sichtungskategorien beschrieben (z.B. Platzbedarf, ruhige Lage), andererseits aber auch konkrete Behandlungsräume als notwendige Ressource benannt.
Personelle Ressourcen wurden nach Fachrichtungen gegliedert sowie getrennt nach ärztlichen und pflegerischen Kräften genannt. Eine Beschreibung des Personals hinsichtlich des Tätigkeitsortes, der Kompetenzen und anhand sonstiger Merkmale wurde ebenso von den Befragten vorgenommen (z.B. Personal des Sozialdienstes und der Verwaltung). Es wurden Aussagen zu möglichen Personalschlüsseln getätigt. Zeitliche Angaben wurden sowohl zur Sichtungs- und Untersuchungsdauer sowie zur Behandlungszeit gemacht.
Maßgebliche Engpassressourcen: In der Literatur, in vorliegenden Verfahren und den Interviews wurden sogenannte potenziell maßgebliche Ressourcen angesprochen, deren Verfügbarkeit prioritär sichergestellt werden sollte, da sie bei einem MANV knapp werden, zu einem Engpass führen oder ein Nadelöhr darstellen können. Sollte sich herausstellen, dass darin tatsächlich allgemein und/oder ereignisnah ein Mangel herrscht, müssten gezielt Gegenmaßnahmen getroffen werden, um Aufnahme- und Behandlungskapazitäten zu erhalten bzw. zu erhöhen. Häufig genannt werden: Personal der Anästhesie und Chirurgie sowie aus dem Bereich der Intensivstation, des Weiteren Tragen, Material für Beatmung, Blutstillung und Infusionen.
Bereits in Tabelle 1 genannte Engpassressourcen sind dort ebenfalls kursiv aufgeführt.
Weitere Engpassressourcen sind die Laborkapazität, die Anzahl der Sichtungspunkte und Blutprodukte, Thoraxdrainagen, ärztliches Personal der Chirurgie mit „Höhlenkompetenz“ sowie bei einer MANV-Verbrennung die Verfügbarkeit von Hautersatzmaterialien und spezialisiertem Personal.
Zeitliche Einflüsse auf Personalressourcen sind zu berücksichtigen – konkret: nachts, am Wochenende, in bestimmten Jahreszeiten (z. B. Feiertage, Urlaubszeit), in Zeiten von Infektionswellen und sonstiger Einflüsse z. B. (Streiks, Semesterpause, etc.).
Diskussion der Ergebnisse
Die auf der Basis der Interviews erstellte Systematik bildet zunächst die Sichtweise der Befragten der Praxis und ihre Relevanzbeurteilungen ab. Zum Zwecke der Erarbeitung wissenschaftlich begründeter Empfehlungen bedürfen sie jedoch noch einer kritischen Prüfung unter Berücksichtigung des Forschungsstandes hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Stimmigkeit.
Auffällig sind zunächst Differenzen in der Bewertung der Lage und Eignung von Räumlichkeiten. So sollte einerseits der grüne Bereich eine räumliche Nähe zur Notaufnahme aufweisen, andererseits aber auch explizit nicht. Hierbei wird dem Bedarf nach kurzen Laufwegen einerseits und der Abschirmung von belastenden Behandlungssituationen für Personal und/oder Patient(inn)en eine unterschiedliche Priorität beigemessen. Ebenso differieren Aussagen zur Möglichkeit der Nutzung anderer Räume als OP-Säle für Operationen.
Unterschiedliche Aussagen finden sich auch in Bezug auf den Einsatz von Personal und die Nutzung von Personal aus anderen Bereichen. Die zu berücksichtigenden Personalschlüssel weisen eine große Spannweite auf, bei denen in den Interviews nicht immer deutlich wurde, ob sie auf persönlichen Erfahrungen, Annahmen oder Leitlinien basieren.
Insgesamt wird der grüne Bereich sehr unterschiedlich hinsichtlich der personellen Ausstattung reflektiert. Der Einschätzung, dass der Abzug von Kräften aus dem grünen Bereich für den blauen Bereich eine wesentliche Personalressource darstellt, folgt möglicherweise einer sehr am Notfall orientierten Handlungslogik und blendet aber möglicherweise aus, dass grüne Patient(inn)en zum einen mehr Beschwerden aktiv mitteilen können und daher auch die Verfügbarkeit von psychosozialem und medizinischem Personal für das Sicherheitserleben relevant ist. Zudem könnte der Wegfall von Personal auch ein regelmäßiges, in geeigneten Zeitabständen erfolgendes Controlling der potenziellen Kritikalität der Patient(inn)en verhindern. Ebenso unterschiedlich wird der Einsatz von ärztlichem Personal der inneren Medizin im grünen Bereich als Ressource bewertet.
Als personelle Ressourcen werden auch Personen aus dem Bereich der Verwaltung und des Sozialdienstes als Ergänzungskräfte im Bereich Rot vorgeschlagen bzw. bereits eingesetzt. Sie können bei der Dokumentation, Lagerung von Patient(inn)en und als Wegweiser unterstützen.
Deutliche Unschärfen oder Ungeklärtheiten zeichnen sich hinsichtlich der psychosozialen Maßnahmen ab. Während im präklinischen Bereich die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) als Querschnittsaufgabe in der medizinischen Versorgung und der Betreuung mit unterschiedlichen Einsatzschwerpunkten bundesweit Konsens ist, werden mehrheitlich keine psychosozialen Kräfte der klinischen Krisenintervention im gelben, grünen und auch nicht im blauen Bereich als personelle Ressourcen benannt.
Abweichend von den präklinischen PSNV-Leitlinien sowie der S2k-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, die den Einsatz von kompetentem psychosozial geschultem Personal vorsehen, sollte hier nach Aussagen der Befragten auch nicht psychosozial geschultes Personal (Öffentlichkeitsarbeit, Logopädie, Sozialdienst, Verwaltung…) mit psychosozialen Aufgaben betraut werden.
Der mögliche Beitrag der Klinikseelsorge, insbesondere auch im blauen Bereich, wird nicht differenziert ausgeführt, ebenso wie deren geringen personellen Ressourcen berücksichtigt. Auch weicht der Betreuungsschüssel von Erfahrungswerten und Konsens in der PSNV ab und wird nicht nach Sichtungskategorie differenziert. Die Aufgabe der Sterbebegleitung wird als zeitliche Anforderung aufgeführt, jedoch kein Bezug zur räumlichen Lage des Bereichs Blau hergestellt.
Zudem fallen Lücken auf. Es wurden kaum Aussagen zum Personalbedarf im blauen Bereich getätigt. Notwendige (medizinische, pflegerische, psychosoziale/seelsorgerliche) Kompetenzen werden nicht benannt. Außerdem wurden keine Personalschlüssel für den Bereich der Sichtung und Rot-Plus benannt, obwohl der Fachdiskurs nahelegt, feste Sichtungsteams zu etablieren. Das mag sich daraus erklären, dass nur eine Person den Bereich Rot-Plus ansprach.
Die Untersuchung lässt auch offen, welche Ressourcen nach der akuten Bewältigungsphase verstärkt benötigt werden und einen Engpass darstellen bzw. zu einem führen können (z.B. Verlegungen, Abbau des Staus von geplanten OPs, Zugehörigeninformation, innerklinische Krisenhilfen für das Personal, Personalplanung nach Ereignisende etc.).
Zusammenfassend ist jeweils ein Diskussionsbedarf in der Erstellung innerklinischer MANV-Konzepte erkennbar. Er betrifft insbesondere die Identifizierung und Priorisierung des Abbaus von Engpassressourcen, Vorplanungen zu Personaleinsatz und (flexibler) Raumnutzung, sowie eine systematische und fachlich qualifizierte Einbindung psychosozialer Maßnahmen für Personal, Patient(inn)en und Zugehörige.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die hier dargestellten Ergebnisse beziehen sich nur auf Unfall-MANV-Ereignisse. Eine gesonderte Bemessung für MANV-Situationen aufgrund von Amoklagen, Terroranschlägen, großflächigen Naturkatastrophen, CBRN-Lagen, KRITIS-Ereignissen, aber auch Schulereignisseen wird dringend angeraten. Evaluationen jüngster Ereignisse (z.B. die Hochwasserkatastrophe an Ahr und Mosel, der Angriff auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt) können dazu beitragen.
Stand zu Beginn der Untersuchung noch das Anliegen im Vordergrund, eine klinikübergreifende Methode der Kapazitätsbemessung zu erarbeiten und gar Mindeststandards von Kapazitäten für die jeweiligen Sichtungskategorien zu definieren, so wird dieser Untersuchungsansatz nun eher kritisch bewertet.
Die jeweiligen Behandlungs- und Kompetenzprofile der Kliniken, aber auch ihr Improvisationspotenzial und Erfahrungswerte beim Einsatz von Kräften und Mitteln bleiben darin nur unzureichend abgebildet. Aufgrund der potenziellen Schwankung des Versorgungsniveaus zwischen Individual- und Katastrophenmedizin kann auch kein fester Ressourcenbedarf im Vorfeld definiert werden.
Im Verlauf der MANV-Versorgung kommt jedoch der transparenten und nach klinikübergreifenden Kriterien systematischen Erfassung, Dokumentation und Kommunikation von jeweilig eingesetzten und verfügbaren Ressourcen in einem klinikinternen und -externen „Lagebild“ eine hohe Bedeutung zu. Diese Untersuchung leistet einen Beitrag zu systematischen Abbildung der (maßgeblichen) Ressourcen zur Sicherstellung der Versorgungsqualität in den Bereichen Allgemeinpflege, Bettenkapazität, Betreibung und Beschaffung, Bereich der Blutprodukte, Geschäftsbereich, innerklinischer Transportdienst (Patient(inn)en und Material), Intermediate Care, Intensivstation, Krankenhausapotheke, Küche, Labor, Logistik, Notaufnahme, OP-Bereich, Personalverfügbarkeit (u. a. OP-Teams), Schockraum, Radiologie, Transport und Wege, Reinigung, Sterilisation, Wäscherei. Weiterführende Bereiche können klinikspezifisch ausgewiesen und hinsichtlich ihrer Relevanz geprüft und optimiert werden.
Als bemerkenswert stellte sich in den Interviews heraus, dass durch die Vielfalt von Alternativen oder eine im Ernstfall veränderte Kombination von Ressourcen oftmals die Kapazitäten beibehalten werden können. Eine starre Standard Operation Procedure könnte diesem flexiblen Umgang mit dem Ereignis im Wege stehen. Um die Potenziale auszuschöpfen, bedürfte es sowohl einer Änderung des Mindsets hin zu mehr Flexibilität, Kreativität, Improvisation und Anpassungsfähigkeit als auch einer Optimierung von Kommunikation und Dokumentation jenseits des Patiententrackings.
Allgemeine Rahmenbedingungen beeinflussen langfristig MANV-Planungen und Leistungsfähigkeitsbemessung. Hier sind gegenwärtig noch die fehlenden gesetzlichen Vorgaben, die Finanzierung adäquater Vorbereitungsmaßnahmen, Fortschritte in der Digitalisierung, Zertifizierungsvorgaben der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Krankenhaus Einsatzplanung (DAKEP) zur MANV-Vorbereitung und der (fach-) ärztliche und pflegerische Personalmangel zu nennen. Bereits heute kann teilweise die räumliche und materielle Kapazität aufgrund personeller Engpässe im Alltagsbetrieb nicht ausgelastet werden.
Dennoch muss die Kapazitätsbemessung als zentrale Komponente der medizinischen und psychosozialen klinikinternen und regionalen MANV-Vorbereitung als Beitrag zur „Public Health Emergency Preparedness“ zukünftig die erforderliche Akzeptanz und Relevanzbewertung erfahren. Innerklinischen Entscheidungsträgern, Kammern und Fachverbänden kommt zur Förderung der Diskussionen und Planungen eine zentrale Unterstützungsfunktion zu.
Autoren: Rainer Schmidt und Irmtraud Beerlage
Erstmals erschienen in: Crisis Prevention 2/2025
Mit WhatsApp immer auf dem neuesten Stand bleiben!
Abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal, um die Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy zu erhalten. Einfach den QR-Code auf Ihrem Smartphone einscannen oder – sollten Sie hier bereits mit Ihrem Mobile lesen – diesem Link folgen: